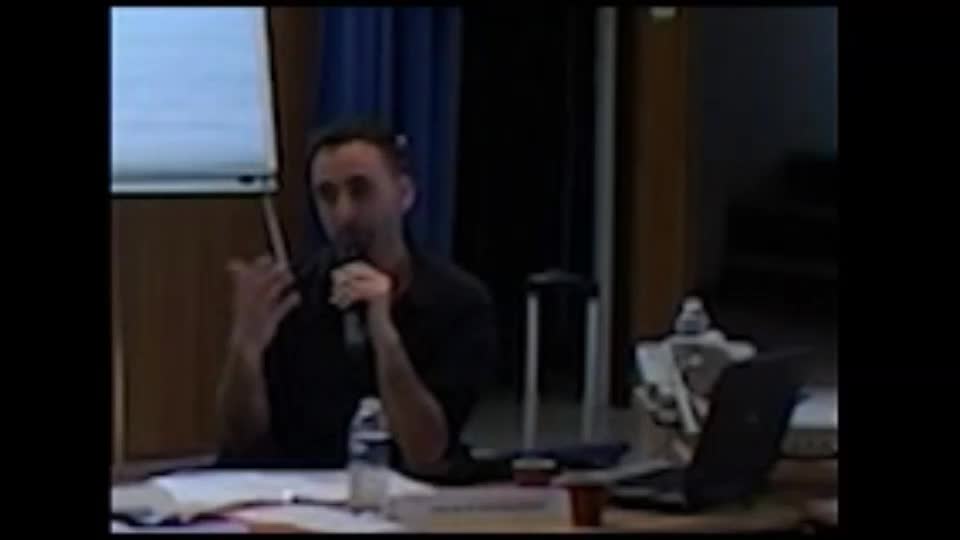Notice
Rencontre avec Steffen Mau - Buchgespräch mit Steffen Mau
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Français :
La réinvention de la frontière au XXIe siècle
La mondialisation est souvent associée à l'effacement des frontières entre les États et à la liberté de circuler. En étudiant les évolutions récentes des frontières, Steffen Mau montre que loin de disparaître, celles-ci se sont transformées au XXIe siècle en machines à trier.
Avec l'aide de la numérisation et des nouvelles technologies de contrôle, elles se muent en smart borders (« frontières intelligentes »), chargées de distinguer entre voyageurs/-euses souhaité·e·s et celles et ceux jugé·e·s indésirables. Ainsi, seul·e·s quelques privilégié·e·s bénéficient d'une liberté de circulation mondiale, tandis que pour le reste de la population, les frontières restent fermées.
En s’appuyant sur des exemples précis, le sociologue analyse ici les formes, les fonctions et les symboliques de ces nouvelles frontières. À rebours de l’image répandue d’un monde contemporain entièrement ouvert, il met en évidence la façon dont elles établissent des inégalités face à la mobilité.
Cet ouvrage propose une approche critique, rigoureuse et inédite du rôle des frontières dans le monde d’aujourd’hui. Steffen Mau y déploie sa réflexion dans une langue claire et accessible, et invite les lecteurs et lectrices à se pencher sur les frontières modernes en remettant en question certains à priori.
Le livre a été traduit par Christophe Lucchese ; préface de Stéphane Rosière, et paraitra le 25 mai aux éditions Maison des sciences de l’homme.
Steffen Mau présentera son livre, qui a été sélectionné pour le prix allemand de non-fiction 2022, lors d'une discussion avec Christian Wille (Université du Luxembourg) et Sylvie Grimm-Hamen (Université de Lorraine). Falk Bretschneider (EHESS) animera la rencontre.
Deutsch :
Sortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert
Der kosmopolitische Traum von einer grenzenlosen Welt hat in den letzten Jahren tiefe Risse bekommen. Aber war er überhaupt jemals realistisch? Steffen Mau zeigt, dass Grenzen im Zeitalter der Globalisierung von Anbeginn nicht offener gestaltet, sondern zu machtvollen Sortiermaschinen umgebaut wurden. Während ein kleiner Kreis Privilegierter heute nahezu überallhin reisen darf, bleibt die große Mehrheit der Weltbevölkerung weiterhin systematisch außen vor.
Während die Mobilität von Menschen über Grenzen hinweg in den letzten Jahrzehnten stetig zunahm und Grenzen immer offener schienen, fand gleichzeitig eine in Wissenschaft und Öffentlichkeit unterschätzte Gegenentwicklung statt. Vielerorts ist es zu einer neuen Fortifizierung gekommen, zum Bau neuer abschreckender Mauern und militarisierter Grenzübergänge. Grenzen wurden zudem immer selektiver und – unterstützt durch die Digitalisierung – zu Smart Borders aufgerüstet. Und die Grenzkontrolle hat sich räumlich massiv ausgedehnt, ja ist zu einer globalen Unternehmung geworden, die sich vom Territorium ablöst.
Der Soziologe Steffen Mau analysiert, auf welche Weise und mit welchen Mitteln die neuen Sortiermaschinen Mobilität und Immobilität zugleich schaffen: Für erwünschte Reisende sollen sich Grenzen wie Kaufhaustüren öffnen, für andere sollen sie fester denn je verschlossen bleiben. Nirgends tritt das Janusgesicht der Globalisierung deutlicher zutage als an den Grenzen des 21. Jahrhunderts.
Steffen Mau präsentiert sein Buch, das 2022 für den deutschen Sachbuchpreis nominiert wurde, im Gespräch mit Christian Wille (Universität Luxemburg) und Sylvie Grimm-Hamen (Université de Lorraine). Das Gespräch wird moderiert von Falk Bretschneider (EHESS).
Intervention
Thème
Documentation
Deutsche transkription
So. Was lange währt, wird endlich gut. Herzlich willkommen im Goethe-Institut zu dieser Veranstaltung. Lieber Herr Mau, herzlich willkommen! Toll, dass Sie jetzt schon wieder da sind. Das ist eine tatsächlich große Freude, auch von mir ganz persönlich. Herzlich willkommen! Originaltitel: Sortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. In Deutschland im Beck Verlag erschienen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, viel Spaß und gute Diskussion.
Ein schön guten Abend auch von meiner Seite. Es ist eben gesagt worden - ich heiße Falk Brettschneider und habe die Ehre und das große Vergnügen, heute durch den Abend zu führen, wie man so schön sagt. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, um dieser Diskussion zu lauschen zu einem Buch über die Rolle von Grenzen in der Weltgesellschaft des 21. Jahrhunderts, von Steffen Mau. Ein Buch, dass… Funktioniert alles technisch? Ja. Ein Buch - es wurde eben erwähnt - dass in Deutschland im Beck Verlag unterschienen ist. So sieht die deutsche Ausgabe aus. Und große Aufmerksamkeit gefunden hat in Deutschland. Es ist es inzwischen auch in mehrere Sprachen übersetzt. Und ich freue mich sehr, dass der Autor sich entschieden hat, die französische Übersetzung dem Verlag, der FMSH anzuvertrauen, wo es, wie es eben gesagt worden ist, vor wenigen Wochen in der traditionsreichen Bibliothèque allemande erschienen ist, in der seit vielen, vielen Jahren wichtige Deutschsprachige Werke der Sozialwissenschaften ins Französische übersetzt werden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verlags ganz herzlich für die Arbeit zu danken. Insbesondere Pascal Rouleau, Astrid Thorn-Hillig und Bettina Sund, die sehr viel für dieses Projekt getan haben. Ich möchte ebenfalls dem Direktor des Goethe-Instituts, Nicolas Ehler, und dem Goethe-Institut überhaupt sehr herzlich für die Gastfreundschaft danken. Und auch ein noch einmal das Centre Georg Simmel und die FMSH erwähnen, die sich an den Kosten dieser Veranstaltung beteiligt haben, was ja auch immer sehr, sehr wichtig ist. Ganz besonders aber freue ich mich und danke ich Steffen Mau, dass er heute zu uns gekommen ist, um mit uns über dieses Buch zu diskutieren. An seiner Seite sind zwei Kolleginnen und Kollegen, die den Weg aus Metz und aus Luxemburg auf sich genommen haben, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Namen sind zwar schon gesagt worden, aber ich würde doch noch mal zu jedem ein, zwei Sätze sagen. Sylvie Grimm-Hamen ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Université de Lorraine in Metz. Nancy. Erster Fehler. Bitte aus dem Video streichen. In Nancy. Arbeitet dort zur modernen deutschen Literatur und Kultur, beschäftigt sich mit Fragen der Interkulturalität und eben auch intensiv mit Fragen der Grenze. Sie war an einem großen Projekt beteiligt, das sich Border Complexities nannte, eine Tagungsreihe, die über mehrere Jahre organisiert worden ist, und organisiert ebenfalls ein Projekt Translor / Ariane, das versucht, sich mit den Grenzräumen zu befassen und ein Kulturportal im Grenzraum zwischen Saar, Mosel, Rheinland und Luxemburg aufzubauen. Mit dieser Grande Région, ist auch Christian Wille verbunden, der an der Universität Luxemburg forscht und lehrt. Dort ist er maßgeblich verantwortlich für das Center for Border Studies, das wiederum an die Universität dieser Großregion angebunden ist. Und er beschäftigt sich seit vielen Jahren aus geografischer und politikwissenschaftlicher Sicht mit Grenzen und hat auch am Projekt Border Complexities teilgenommen. Aber das ist eher ein Zufall, dass das heute so ist. Ich danke beiden noch mal sehr herzlich, dass sie heute gekommen sind, um mit Steffen Mau zu diskutieren, der selbst Professor für Makrosoziologie an der Humboldt Universität zu Berlin ist. Er ist in Rostock aufgewachsen, also in der ehemaligen DDR, hat an der Freien Universität in Berlin studiert, am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz promoviert. Zahlreiche Gasteinladungen ins Ausland erhalten, unter anderem auch zu Sciences Po in Paris und 2021 den renommierten Leibniz-Preis gewonnen. Das ist der wichtigste Preis, den die deutsche Wissenschaft zu vergeben hat. So etwas wie eine Goldmedaille des CNRS hat also in seinem Leben viele Grenzen überschritten, was vielleicht eine gute Überleitung zur ersten Frage ist. Ich würde aber kurz noch zwei Sätze zu mir selbst sagen. Ich lehre und forsche an der École des hautes études en sciences sociales. Beschäftigen mich dort insbesondere mit Fragen der Geschichte der Strafjustiz und der Räume des Alten Reichs. Und habe vor einigen Monaten eine Habilitation abgeschlossen zum Thema der Verbannungsstrafe im Alten Reich. Auch das hat viel mit Räumen und Grenzen zu tun. Also wir sind alle heute hier auf dem Podium irgendwie einschlägig vorbelastet. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach an! Es ist schon erwähnt worden. Steffen Mau hat nicht nur dieses tolle Buch über die Grenzen geschrieben, sondern er hat auch ein anderes Buch geschrieben, das vor einigen Jahren für viel Aufmerksamkeit in Deutschland gesorgt hat und ebenfalls im Programm der FMSH übersetzt worden ist. Lütten Klein: Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Ein überaus wichtiges Buch, das sich mit der Frage beschäftigt hat, was die Wende in der DDR mit den Menschen dort gemacht hat und welche Folgen das bis heute in der gesamtdeutschen Gesellschaft hat. Über dieses Buch wollen wir heute nicht sprechen. Aber ich komme nicht umhin, mit einer Frage an den Autor zu beginnen. Ich bin selbst in der DDR groß geworden. Wir sind übrigens heute - das kommt nicht so oft vor - drei Menschen hier auf dem Podium, die in der DDR groß geworden sind. Und kann mich natürlich sehr gut erinnern, welchen… Also Christian Wille auch. Sylvie Grimm-Hamen nicht. Das lässt sich auch nicht mehr nachholen, Sylvie. Leider, das ist zu spät. Also ich kann mich natürlich sehr gut und ich glaube, wir können uns alle drei sehr gut erinnern, welches Gewicht die Grenze, die Mauer für den Alltag in der DDR hatte. Und nun ist in dem neuen Buch über die Grenzen… Es ist kein autobiographisches Werk wie Lütten Klein. Es gibt ein paar kurze Bemerkung am Anfang des dritten Kapitels, aber ansonsten tritt die biografische Erfahrung des Autors doch sehr zurück. Und ich wollte beginnen mit der Frage, ob es nicht doch vielleicht einen kleinen Zusammenhang gibt zwischen einer Kindheit und Jugend in der DDR und einem Buch über Grenzen.
Ja, natürlich ist Forschung oder eine wissenschaftliche Reflexion eines Themas immer mit biographischen Aspekten verbunden. So ist es hier natürlich in besonderer Weise, weil gerade wenn man jetzt aus der ehemaligen DDR kommt und die innerdeutsche Teilung und auch die Berliner Mauer kennengelernt hat, dann ist vielleicht diese Frage, welche Rolle Grenzen spielen, als Ordnungssystem oder als Ordnungsinstitution ja irgendwie naheliegend. Ich hatte immer eine große Faszination, sowohl für die Öffnung von Grenzen und für den Fall der Mauer, aber natürlich auch für neue Schließungsformen von Grenzen. Das war in gewisser Weise ein Ausgangspunkt und auch eine permanente Kritik, die ich immer hatte an diesem gesamten Globalisierungsdiskurs, weil er mir eine zu starke Öffnungsneigung hatte. Also zu stark irgendwie doch der Illusion anheim gefallen ist. Ja. Grenzen spielen eigentlich keine so große Rolle mehr. Und es gibt ja auch andere Bücher. Zum Beispiel von Lea Ypi - das Buch Frei, das vor zwei oder einem Jahr erschienen ist, die aus Albanien kommt und die so eine ähnliche Beobachtung letzten Endes macht. Sie sagt, es gibt doch diese Doppeldeutigkeit auch im liberalen System, dass einerseits sozusagen Freiheit und Freiheitsgewinne unglaublich hoch im Kurs stehen, aber die Kehrseite häufig übersehen wird. Das war so ein bisschen ein Ausgangspunkt auch für dieses Buch. Bevor Sie jetzt zu Ihrer zweiten Frage kommen, will ich natürlich noch die Gelegenheit nutzen, auch dem Verlag und auch dem Goethe-Institut und Ihnen allen hier zu danken, dass die Veranstaltung möglich ist und natürlich auch, dass das Buch erschienen ist im Französischen. Das ist natürlich eine unglaublich fantastische Sache und auch Frau Sund die das über eine lange Zeit toll unterstützt und begleitet hat und auch der Übersetzer, der heute leider nicht da ist, Christophe Lucchese. Also es ist einfach fantastisch, wenn das Buch dann da ist und man das in den Händen hält und dann leider kein Französisch lesen und sprechen kann, aber doch sieht, dass das eigene Buch ist und dass es toll ist in einer anderen Sprache publiziert worden ist.
Das kann ich gut nachvollziehen und ich bin mir ziemlich sicher, die Übersetzung ist sehr gelungen, wie alle Übersetzungen in der Bibliothèque allemande. Die zentrale These des Buches lautet, dass in der globalisierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, die angeblich die ganze Welt umfasst, dass diese globalisierte Gesellschaft des 21. Jahrhunderts tatsächlich eine Gesellschaft ist, die durch Grenzen durchzogen ist. Eine fragmentierte Gesellschaft, in der eine kleine Elite, zu denen, glaube ich, mehr oder weniger alle in diesem Saal zählen, relativ frei herumreisen kann, währenddessen für viele, viele andere Mobilität permanent an Barrieren stößt. Ich glaube, die Diskussion um den Asylkompromiss in Brüssel vor ein paar Tagen haben die Problematik uns allen noch mal in Erinnerung gerufen. Und ich glaube, auch da gibt es ein paar sehr interessante Kapitel im Buch, die diese Diskussion erhellen. Auf dem deutschen Titel… Wir haben kurz vorher schon mal darüber gesprochen. Auf dem deutschen Titel, finde ich, wird diese Problematik durch das kraftvolle Bild der Sortiermaschine ausgedrückt. Der findet sich auf dem französischen Titel nicht. Dafür gibt es sicherlich gute verlegerische Gründe. Aber vielleicht können Sie mithilfe auch unserer Simultanübersetzerin Cornelia Geiser der ich sehr herzlich für ihre schwierige Arbeit danken möchte, noch einmal versuchen zu umreißen, was Sie mit dem Bild der Sortiermaschine meinen.
Ja, das ist im Prinzip eine Metapher. Es gibt auch Sortiermaschinen in vielen anderen technischen Feldern. Und nach dem Erscheinen des Buches habe ich auch mal Bilder zugeschickt bekommen. Von Sortiermaschinen, die zum Beispiel Obst und Gemüse sortieren oder Kleingeld sortieren. Und einige… zum Beispiel eine große Logistik-Sortiermaschine, die hatte genau dieselben Farben, also rosa und grün wie die deutsche Ausgabe. Das war schon verblüffend. Ja, worum geht es eigentlich? Es geht eigentlich um die These - Öffnungsprozesse finden statt. Die Globalisierung hat natürlich auch Grenzen poröser gemacht, hat auch mehr grenzüberschreitende Mobilität mit sich gebracht. Aber genau zu dem Zeitpunkt, wo das stattgefunden hat, sind Grenzen auch geschlossener geworden. Grenzen sind eben ja auch Unterscheidungsinstitutionen. Die unterscheiden zwischen denjenigen, die eine Grenze passieren können, und denjenigen, die sie nicht passieren können. Und die These des Buches ist nicht nur, dass wir in so eine Art, stratifizierter Gesellschaft ungleicher Mobilität-Chancen leben, sondern dass die Mobilitätsgewinne der einen kausal mit Mobilitätsverlusten der anderen verknüpft sind. Also in dem Moment, wo wir eigentlich unsere Möglichkeiten ersteigern, wo eigentlich die Globalisierung ansetzt, steigt eigentlich auch das Bedürfnis, Räume wiederzuvergrenzen, Übergangsmöglichkeiten zu schließen. Man kann sich das wirklich so vorstellen. Es öffnet sich ganz viel und gleichzeitig wird es eben selektiver. Die Sortiermaschine ist eben ein sehr komplexes Arrangement aus Technologie, aus Personal, aus Infrastruktur, auch aus unterschiedlichen Akteurskonstellationen, das genau dazu dient, diese Art von Selektivität durchzusetzen. In dem Buch interessiert mich gar nicht so stark die Grenze als Raumtrenner. In dem Sinne… Also es gibt eine Linie auf dem Sand, wo sich zwei Staatsgebiete treffen, sondern viel stärker die Grenze sozusagen als operatives Arrangement der Durchsetzung selektiver Mobilitätschancen. Und da ist eben diese Janusköpfigkeit der gleichzeitigen Erzeugung von Mobilität, in den ebenen Grenzüberschreitungen leicht gemacht werden. Das es alles ganz flüssig durchfließen soll, das ist ja letzten Endes, wenn man heute am Flughafen ist… Ich bin heute in Orly angekommen und man läuft dann da natürlich durch eine Shoppingmeile und kann da einkaufen. Das soll also ganz komfortabel sein. Gleichzeitig erzeugt die Grenze des 21. Jahrhunderts eben Immobilität. Also fixiert Menschen an bestimmte Orte, häufig an Herkunftsorte, aber auch an Transitorte oder sogar in Lagern. Sozusagen diese Gleichzeitigkeit, die, finde ich, ist auch gerade jetzt in der Geschichte der letzten Tage mit der Frage, wie die Europäische Union eigentlich mit humanitärer oder Asylmigration umgehen soll, noch mal sehr, sehr deutlich geworden. Die Leute sollen einfach dann 12 Wochen in solche Auffanglager gebracht werden. Das Argument, was ich jetzt immer wieder gehört habe: das sind ja gar keine Kasernierungen im eigentlichen Sinne. Die können ja zurückgehen, das heißt, man kann die eigentlich verlassen. Das ist natürlich in gewisser Weise ein perfides Argument, wenn man unterstellt, dass einige Leute da eben verfolgt sind. Und der Anteil liegt ja nicht bei 0,0% oder 0,01%, sondern da geht es ja auch um Herkunftsländer, wo es Anteile gibt, dann von 10% von Personen, die letzten Endes ihr Asylrecht geltend machen können und dann nicht zurückgewiesen werden. Und das ist natürlich ein Argument, das ich nicht besonders überzeugend finde.
Das ist vielleicht ein guter Übergang, um die beiden anderen auf dem Podium mit einzubeziehen. Die Frage, ob Grenze überhaupt jemals das gewesen ist, was wir uns landläufig vorstellen, ist, glaube ich, eine Frage, über die wir noch mal sprechen sollten. Mir scheint es so zu sein, dass die Dialektik von Öffnung und Schließung letzten Endes immer in unterschiedlichen Graden wirksam gewesen ist. Es gibt ja inzwischen sogar Untersuchungen, dass auch die Berliner Mauer so undurchlässig dann letzten Endes doch gar nicht war, wie wir sie vielleicht erlebt haben. Aber Christian, vielleicht kannst du im Lichte deiner eigenen Forschungen etwas dazu sagen, was du aus dem Buch von Steffen Mau gelernt hast, wie sich das auch zur allgemeinen Grenzforschung im Moment verhält. Was ist der Gewinn, den du aus dem Buch gezogen hast?
Ja, danke. Ich danke für das Wort und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen und mich recht herzlich bedanken, dass ich heute hier sein darf und auch mit Steffen Mau direkt sprechen kann und auch mit meinem Kolleg*innen. Ich erinnere mich… Ich muss zugeben, ich habe die französische Fassung nicht gelesen, weil ich die deutsche Fassung schon bei der Herausgabe gelesen hatte, im Jahr 2021. Das heißt, ich kannte das Buch schon eine Weile, habe es aber mehrfach gelesen und ich kann mich auch noch gut erinnern. Das war damals im Sommer 2021, da war ich an der Universität Flensburg zu einem Aufenthalt, auch in einer Grenzregion. Da war gerade ganz viel Pandemie usw. und da hat das Buch sehr, sehr inspiriert und es war auch wirklich eine Fundgrube. Und es war auch eine Fundgrube, weil wir damals nicht so einen…, weil wir damals auch über ein ähnliches Thema gearbeitet haben. Wenn ich sage wir, dann sind es Kollegen aus der Großregion und ich, aber wir hatten nicht so einen starken und wirklich sehr guten Begriff wie der Sortiermaschine. Wir haben über Multivalenz gesprochen, die Multivalenz der Grenze, also dass die Grenze unterschiedliche Wertigkeiten hat für verschiedene Personengruppen. Und, ich möchte aber gerne bei der Sortiermaschine bleiben. Beziehungsweise eben fiel der Begriff der Ordnungsmaschine; Grenze und Ordnung, das hängt ja immer…, also das ist ja miteinander total verquickt, das sieht man ja im Englischen auch. Wenn es heißt: "border", da ist ja die Idee von Order, also eine gewisse Ordnung schon mit drin im Wort. Da wird das ganz, ganz deutlich und Grenzen stehen für Ordnung und Grenzen ordnen auch. Also es gibt auch diese beiden Funktionen und worauf ich hinaus will, ist: Die Sortiermaschine schafft Ordnungen oder setzt Ordnungen um. Aber was treibt sie an? Also was sind die, Sie nennen das in Ihrem Buch "Sortierlogiken" oder auch "Ordnungslogiken"? Und das finde ich aus Sicht der Grenzforschung ungeheuer spannend, dezidiert zu schauen und zu untersuchen: Die Ordnungen, die über eine Grenze irgendwie umgesetzt werden, sich materialisieren, die sozial wirksam werden oder wie man sagt, die sich auch räumlich formen, dann also, die im Raum auch ihre Spuren hinterlassen, wo kommen die her, wer setzt die? Wie verändern die sich, wie werden die umkämpft? Und meines Erachtens ist, wenn man Grenzen heute verstehen möchte, ist da der Zugriffspunkt, dass man schauen muss: Was ist eigentlich der Treibstoff dieser Maschine, dieser Sortiermaschine? Sie haben bestimmt auch was geschrieben im Buch dazu. Vielleicht habe ich überlesen, aber vielleicht können Sie auch was dazu sagen.
Ja, das ist ja sozusagen erst mal ein schlankes Buch. Das ist kein Opus magnum, das die gesamte Grenzforschung jetzt noch mal versucht neu zu konturieren. Im Hinblick auf die Antriebskräfte bin ich relativ unspezifisch. Also sage ich schon, es gibt so allgemeine Globalisierungs-Entwicklungen und die bedingen das mit. Und ich glaube, es gibt auch gute Gründe, das erst mal so zu sagen. Ein Argument ist ja letzten Endes, dass Grenzen eigentlich in den 60er Jahren zum Beispiel offener gewesen sind. Wenn man jetzt die Visumpolitik sich anschaut, also man konnte relativ leicht aus dem Senegal oder aus der Elfenbeinküste in ein europäisches Land, nicht in alle, aber nach Belgien oder nach Österreich oder so was kommen. Und warum hat sich das eigentlich geändert? Ja, weil damals nur 200 oder 250 Leute pro Jahr das in Anspruch genommen haben. Jetzt gibt es natürlich ein globales Modell, auch sozusagen letzten Endes auch ein westlicher Lebensstil, der allen Leuten zeigt, mobil zu sein, sich an allen Orten der Welt aufzuhalten, ist irgendwie sozusagen ein zentraler Kennwert des gesellschaftlichen Lebens. Und natürlich dringen Touristen aus aller Welt auch in alle Ecken dieser Welt. Und dann wundern sich Leute natürlich schon: Ja, warum gibt es da keine Reziprozität? Warum können wir nicht das machen, was andere eigentlich für sich in Anspruch nehmen? Und dann kann man eben sehen, zum Beispiel in Bezug auf die Visumpolitik oder das Visum freier Reisen, dass genau in dem Moment, wo dann die Leute das tatsächlich in Anspruch nehmen, das wieder zurückgenommen wurde. Und vielleicht das für uns drei jetzt präsenteste Beispiel oder die Beispiele, die man finden kann, ist der Fall des Eisernen Vorhangs. Da hat der Westen natürlich jeden Tag gepredigt, Reisefreiheit ist sozusagen Kern des Freiheitsbegriffs und die wird verweigert durch eine kommunistische oder staatssozialistische Diktatur. Und das war ja auch ein großes Problem. Und alle sollen doch eigentlich die Möglichkeit haben, zu kommen. Aber in dem Moment, als natürlich die Mauer gefallen ist oder der Maschendrahtzaun zwischen Österreich und Ungarn durchgeschnitten worden ist, dann haben die plötzlich festgestellt: Ja, die nehmen das jetzt tatsächlich in Anspruch. Ja, verrückt, also jetzt wollen die alle kommen. Und dann haben natürlich viele Länder wie Österreich und andere auch erst mal die Visumpflicht eingeführt und gesagt: Ja, jetzt müsst ihr aber ein Visum beantragen, weil wir wollen euch ja gar nicht alle haben. Und nochmal, in Lea Ypis Buch wird das auch sehr gut beschrieben. Gerade Albanien, gab es dann eben Massenfluchten, also richtige Boatpeople, Leute, die versucht haben, nach Italien zu kommen im Zuge der Wirtschaftskrise 1997, die dann da auch massenhaft zum Teil ertrunken sind. Weil der Westen, der immer im Prinzip gepredigt hat, man muss die Leute auch dann irgendwie, man muss denen Freizügigkeit geben und Mobilitätsrechte sind auch Kern des Freiheitsbegriffs, hat das dann nicht mehr eingehalten. Denn letzten Endes, die Freiheit, ein Land zu verlassen ist ja nichts wert, wenn man in kein anderes Land einreisen darf. Also es braucht ja irgendwie eine Destination, irgendwie ein Reiseziel, das man in Anspruch nehmen kann. Und von daher glaube ich sozusagen, dass diese realen Entwicklungen die ansteigende Mobilität insgesamt oder das, was man als Globalisierung fassen kann, dass das schon ein ganz wesentlicher Treibstoff dieser Veränderung von Form der Grenzkontrolle, um die geht es mir ja letzten Endes, ist.
Ich würde da gerne gleich nachfassen, aber erstmal Sylvie die Chance geben, auch was…
Auf die Antwort von oder auf die Frage von Christian glaube ich, geben Sie auch noch eine andere Antwort, die auch interessant ist, nicht so ausgeführt wird, weil das Buch in der Tat kurz und bündig und deswegen auch sehr einleuchtend wirkt. Sie sagen, eines der Merkmale der globalisierten Grenze oder der Grenze in einer globalisierten Welt ist auch diese Verzahnung von privaten und staatlichen Akteuren. Das heißt, diese Sortierarbeit wird nicht nur von staatlichen Behörden geleistet, sondern immer mehr auch privaten Akteuren delegiert, von denen man ja auch nicht genau weiß, wie die kontrolliert werden. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, glaube ich, den Sie am Ende betonen im Buch.
Ja, das ist klar, dass ich sage, das gibt eine Wegbewegung eigentlich von so klassischen hoheitlichen Aufgaben, die auch letztendlich so eine territoriale Bindung hatten. Also die Schlagbaumgrenze, die wir kennen, man kommt da hin, man zeigt seinen Pass vor und dann gibt es einen staatlichen Beamten oder eine Beamtin, die kontrolliert das und dann winkt die einen durch oder nicht. Und heute sieht man eben, dass letzten Endes auch Verantwortung diffundiert, dass andere Akteure, private Akteure, aber auch andere Staaten, zum Teil auch NGOs, mit eingebunden werden in spezifische Kontrollaktivitäten. Gerade bei den NGOs gibt es eben diese Mischung aus Control und Care, also es ist beides. Also einerseits gibt es ein humanitäres Interesse zu helfen und die Menschenrechte einzuhalten, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Formen von Kontrolle, zum Beispiel in solchen Lagerkontexten. Und dann gibt es diese unglaublich starke Verlagerung eben von Grenzkontrollaufgaben. Mein Fokus sind schon staatliche Institutionen, aber ich sage eben auch, dass verändert sich eben dadurch. Ja, was ist denn eigentlich die neue Grenze? Die neue Grenze, wenn die nicht mehr territorial fixiert ist, dann diffundiert sie eigentlich im öffentlichen Raum. Es gibt eine Grenze vor der Grenze und es gibt eine Grenze hinter der Grenze. Und der Schengenraum ist so typisch. Da hat man ja da auch gesagt, wir schaffen Grenzkontrollen ab, die sind gar nicht mehr sichtbar. Aber dafür darf sozusagen bis zu 30 oder 50 Kilometer innerhalb des Landes kontrolliert werden auf Autobahnen usw. Yuval-Davis hat so einen Begriff des "Everyday Bordering", die macht das am Beispiel von England, dass sie eben zeigt, es werden auch dann immer mehr sozusagen Privatleute, die Wohnung vermieten oder Jobs vergeben mit kleinen Kiosken. Die wären dann verpflichtet, an staatliche Instanzen zu melden, wenn sie irgendwie jemanden ohne reguläre Aufenthaltspapiere antreffen oder der sich um eine Wohnung bewirbt. Und es gibt die Verschiebung der Grenze natürlich nach außen, also eine Art von Exterritorialisierung von Grenzkontrolle, sogar fast eine Globalisierung von Grenzkontrolle. Dass die Grenze eigentlich gar nicht mehr da stattfindet, wo sie verläuft, sondern in der Subsahara oder an den europäischen Außengrenzen oder an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien. Also es werden eben werden Migrationsregime entwickelt, die weit über das Territorium der Europäischen Union hinausgreifen. Die Digitalisierung ist natürlich auch so ein Fall. Gibt es jetzt erst vor kurzem gelesen, dass in den USA jetzt Biden Anfang des Jahres eine neue App eingeführt hat. Und da müssen sich Personen, die aus Mexiko kommen und Asyl in den USA beantragen wollen, müssen sich vorab, bevor sie die USA erreichen und einreisen, über diese App registrieren und einen Termin für ein Asyl-Interview machen. Es gibt 1.000 Slots pro Tag, es werden Dokumente hochgeladen und das Ziel ist, diese App so auszubauen, dass man diese Interviews virtuell halten kann. Die Leute brauchen gar nicht mehr ins Land. Die sitzen irgendwo in El Salvador oder in Mexiko und die gesamte Asylprozedur wird dort gemacht. Und wenn man das nicht macht, dieses Interview nicht vorab schon im Transit oder im Heimatland beantragt und es schafft, da dann einen Termin zu bekommen, dann wird das Asylverfahren nicht prozessiert in den USA. Also man kann nicht einfach hingehen. Und das sind natürlich enorme Entwicklungen, es sind enorme Veränderungen. Da braucht man natürlich auch Technologieunternehmen, die das abwickeln, die wir uns gar nicht mehr vorstellen. Das ganze Bild der Grenze, das wir klassischerweise im Kopf haben, nämlich, dass sie eben eine territoriale Fixierung hat und auch die Grenzkontrolle irgendwo da stattfindet, wo der Eintrittsort in ein Territorium ist, das muss man eigentlich aufgeben.
Darf ich da kurz nachfragen? Also ich finde, wir sind jetzt relativ schnell von der Frage Reisefreiheit für Osteuropäer nach dem Fall der Mauer bei der Asylfrage gelandet. Muss man da nicht doch noch mal ein bisschen begrifflich spezifizieren und ein bisschen genauer sagen, worüber wir sprechen? Also mir leuchtet das Argument sehr ein, dass Grenzwirkungen auf unterschiedlichen Ebenen sich verstärken, die Kontrollmechanismen komplexer werden. Aber für wen? In welchen spezifischen Situation? Also werden tatsächlich ganze Bevölkerungen einfach pauschal am Reisen gehindert? Oder geht es nicht tatsächlich darum, Migrationsströme nicht nur zu lenken, sondern tatsächlich auch einzuschränken? Also sind das nicht unterschiedliche Dinge, die da zwar alle zusammenfließen und in der Sortiermaschine sich gewissermaßen treffen, aber nicht immer exakt das Gleiche meinen?
Absolut, da stimme ich Ihnen zu. Und ich versuche das auch ein bisschen zu sortieren. Aber es ist nicht ganz einfach, weil, ich sage vielleicht manchmal eine Zahl, die ich irgendwo mal gelesen habe, aber ich habe das nie wieder gefunden. Nur einer von 1.000 Grenzübertritten hat irgendwie eine Beziehung zu Migration. Alles andere ist Tourismus, Familienbesuche, kleiner Grenzverkehr, Sonstiges. Und wenn Leute mich fragen: Ja, in deinem Buch geht es doch so um Migration? Dann sage ich ihnen: Nein, es geht um Mobilität, also ein viel größere Korb, viel, viel mehr. Aber: Mobilität wird heute vor allen Dingen deswegen auch so harsch reguliert, weil es diesen Schatten der Migration gibt oder den Verdacht der Migration. Also Menschen aus dem Senegal können ja nicht nur deswegen nicht einreisen nach Europa, weil man sie nicht als Touristen haben möchte, sondern weil man vermutet, sie würden Visa-overstayer werden, also sie würden regulär kommen und dann bleiben. Oder sie würden irgendwie irreguläre Migranten werden. Von daher ist das beides natürlich irgendwie miteinander verknüpft. Und wenn wir die Migrationsfrage nicht hätten, dann würden diese 999, die mit Migration gar nichts zu tun haben, ganz anders betrachtet werden. Und die anderen 100.000, die irgendwie mobil sein möchten, auch. Da hätten wir eine viel offenere Gesellschaft. Von daher ist natürlich… Diese Sicherheitsfrage spielt sicher eine Rolle. Aber ganz wichtig ist im Prinzip immer die Rückbeziehung zur Migrationsfrage und dass wir uns abschotten, dass die Grenzen diese Sortierfunktion ausgebildet haben. Die natürlich, die gab es schon immer, aber ich glaube, sie ist intensiver und letzten Endes großflächiger geworden. Das hat eben was damit zu tun, dass die Migrationsfrage uns so intensiv beschäftigt und Gesellschaften offensichtlich sehr panisch darauf reagieren, wenn sie das Gefühl haben, es gibt einen starken Migrationsdruck und sie könnten Migration, wie sie stattfindet, nicht so ohne Weiteres bewältigen. Auch die Frage, natürlich würde es keine Mauer zwischen Mexiko und den USA geben, also wenn… Und es würde auch keine Pushbacks und auch nicht 20.000 Tote in den letzten 10 Jahren im Mittelmeer geben, wenn nicht der Verdacht wäre ja, das geht da immer um Migration. Und da geht es natürlich auch um Migration, aber das schließt natürlich viele andere auch aus. Das schließt natürlich auch Spitzenwissenschaftler*innen aus Dakar aus, die in Paris oder in Berlin eine Konferenz besuchen wollen. Also alle möglichen Leute werden letzten Endes auf Verdacht immobilisiert. Und das finde ich eben in einen sozusagen problematischen Kontext, in den das gestellt wird.
Sylvie.
Auch, um jetzt nochmal auf deine Frage zu reagieren: Ich glaube, das Buch spricht auch gerade diese Problematik an, dass Grenzen in einer globalisierten Welt ständig umkodiert werden. Das heißt, sie lassen sich nicht auf eindeutige Kategorien definieren, festlegen. Das sagen Sie ganz schön am Ende, finde ich. Sehr prägnant. Diese Kategorien, das ist mal Sicherheit, das ist mal dann Krankheitsgefahr, das ist mal was anderes. Das variiert und wird ständig umgedeutet. Das heißt, es lässt sich eben mit keiner binären Logik erfassen und vielleicht nicht auf eindeutige Kategorien festlegen.
Ja, letzten Endes, wenn wir jetzt die COVID-Pandemie noch mal nimmt, zu der sie ja auch gearbeitet haben: Das ist eben so ein Fall der Grenzschließung, wo letzten Endes Menschen als Risikoträger, diesmal für ein gesundheitliches Risiko, klassifiziert werden und deswegen von Reisemöglichkeiten ausgeschlossen werden. Aber selbst vom Ausschluss kann es wieder Ausschluss geben. Wenn man sozusagen die Personen, die in Fleischfabriken oder auf Spargelfeldern in Deutschland gearbeitet haben während der Pandemie, dann hat man dann eigens aus Rumänien, aus Cluj Flieger abheben lassen, weil man gesagt hat: Ja, das ist jetzt im Interesse der Volkswirtschaft oder der Nahrungsmittelsicherheit oder des Spargelkonsums in Deutschland und deswegen muss das eben möglich sein, trotzdem mobil zu sein. Und da sieht man schon die Selektivität. Also man kann dann auch bestimmte Risiken dann wieder nach hinten schieben, wenn andere Formen der Nützlichkeit irgendwie priorisiert werden. Und so findet das eigentlich permanent statt, dass das keine fixe Regel von Ein- und Ausschluss oder von Zugang und Nicht-Zugang ist, sondern dass Staaten permanent eigentlich an diesen Stellschrauben versuchen zu drehen. Man kann auch - also das ist vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Man kann das natürlich auch das freie Reisen als… Ja, wie soll man sagen, in Verhandlungen selber als Würstchen mit in so einen Verhandlungsprozess hineinzugehen. Der EU-Türkei-Deal nach der Flüchtlingskrise 2015 hat ja genau beinhaltet, dass Menschen aus der Türkei oder mit türkischem Pass dann in Folge visumfrei in die Europäische Union reisen können. Das ist ein Riesenpfund, was die Europäische Union da hineinbringen kann. Jetzt die Diskussion in Tunesien mit Ursula von der Leyen und Mark Rutte und anderen, genau dasselbe. Also wir würden es für Tunesier leichter machen, nach Europa zu kommen, wenn ihr Eure Grenzen sichert. Das heißt, man macht letzten Endes ein Angebot an diese Länder und was die dafür tun müssen, ist eigentlich die Mobilität von anderen, von Dritten, beschränken. Und das ist irgendwie auch eine sehr perfide Strategie. Das hat die EU jetzt mit der Türkei zum Beispiel nie so richtig eingelöst. Da gibt es ja auch immer Beschwerden dazu, dass eigentlich dieser Türkei-EU-Deal unvollständig dann realisiert worden ist. Aber so wird das jetzt gemacht, also um einfach andere Staaten mit einzubinden in die eigenen Migrations-Kontrollinteressen.
Das ist einer der Punkte, den ich wirklich faszinierend fand beim Lesen. Also es gibt ja so ein zweites Narrativ, mit der Globalisierung ist der Nationalstaat verloren gegangen. Oder der Nationalstaat ist völlig handlungsunfähig geworden, oder… Also Angela Merkel hat ja die Grenzöffnung 2015 durchaus auch damit begründet, Grenzen würden sich ja gar nicht mehr kontrollieren lassen und so weiter und so fort. Und ich finde, Sie zeigen sehr schön auf, dass das gar nicht stimmt, sondern dass sozusagen über die Globalisierung Nationalstaaten neue Handlungsfelder erschließen und neu handlungsfähig werden, indem sie eben global agieren. Das finde ich wirklich sehr eindrucksvoll geschildert. Und ich glaube, der Prozess der Exterritorialisierung von Grenzen, der Vorlagerung von Grenzen ist dafür ein ausgesprochen gutes Beispiel.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wo ich dann im Prinzip sage: Ja, wir reden ja hauptsächlich über liberale Staaten, also Staaten, die eine Art von normativer Selbstbindung zum Beispiel an ihre Verfassung haben, an internationale Verträge wie die Genfer Flüchtlingskonvention und anderes. Und als Folge davon sind natürlich ihre Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Es gibt dieses Non-Refoulement-Prinzip, also das Prinzip der Nicht-Zurückweisung von Geflüchteten an den eigenen Grenzen und die Selbstverpflichtung für diese Menschen, dann reguläre Asylverfahren herbeizuführen. Ja gut, wenn man diese Bindung hat, dann heißt das natürlich, dass viele Menschen klopfen können. Und dann hat man ja schon in den 90er Jahren, in Deutschland jedenfalls, diese sichere Drittstaatenregelung nach den Ereignissen in Rostock-Lichtenhagen herbeigeführt. 1993, und später das dann immer weiter erweitert. Und in der Folge heißt das letzten Endes, dass man gar nicht mehr so einfach in einem Land Asyl beantragen kann. Ich vergleiche das da in dem Buch letzten Endes wie ein Inselstaat, der sagt: Man kann nur Asyl bei uns bekommen, wenn man über den Landweg einreist. Also de facto eigentlich unmöglich. Und so ist das ja sozusagen im Inneren der Europäischen Union auch, weil ja nach dem Dublin-Verfahren eigentlich alle Außenländer der Europäischen Union und die mit Außengrenzen notwendigerweise diese Asylverfahren durchführen müssten. Und das, finde ich, ist sozusagen eine Folge dieser normativen Selbstbindung. Es sind eigentlich Versuche, die Grenzkontrolle so zu organisieren, dass man so etwas hat wie illiberale Beinfreiheit. Also man kann woanders hingehen und kann dort Dinge tun, die man an der eigenen Grenze, am eigenen territorialen Saum nicht machen könnte. Und deswegen macht man das auch. Und deswegen ist häufig das Versprechen, das ist ja auch eine große Diskussion, ja, was müssen wir eigentlich machen, wenn die Grenze sich verlagert? In Herkunfts- und Transitländern müsste sich eigentlich auch das Rechtsprinzip verändern. Das Recht müsste eigentlich mitwandern dahin, wo Grenzkontrolle ausgeübt wird. [inaudible], eine kanadische Rechtswissenschaftlerin, argumentiert zum Beispiel genau so. Und ich hatte auch schon mehrere Diskussionen, gerade letzte Woche, mit ihr, weil ich sage: Ja, das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das stattfinden wird, weil genau der Grund ja ist, dem auszuweichen. Darum wird das ja gemacht. Und das mag ja irgendwie aus einer rechtlichen Perspektive sehr wünschenswert sein, dass das so ist. Wir haben ja alle große Zweifel, ob die Zentren an den Außengrenzen der Europäischen Union im Prinzip die rechtlichen Standards überhaupt durchsetzen können, die den Standards gleichen, die wir im innerstaatlichen Kontext für gut und richtig halten. Auch Zugang zu anwaltlichem Beistand, die Zivilgesellschaft, die politische Öffentlichkeit, das sind ja alles Aspekte, die damit hineinspielen. Und da würde ich schon sagen, da habe ich meine Zweifel. Und ich glaube einfach, die Exterritorialisierung von Grenzkontrolle ist eigentlich eine sehr clevere Strategie, um dem, was man eigentlich nicht möchte, auszuweichen. Und in dem Sinne höhlt man natürlich das gesamte Asylrecht aus. Wir leben ja nur noch in einer Fiktion, indem wir so tun, als ob das möglich wäre, Asyl zu beantragen. Aber es gibt eben diese starke, ja diese starke Prämie derer, die es überhaupt schaffen, bis an die Grenze zu kommen. Viele schaffen es ja gar nicht. Und weil diese Form der Exterritorialisierung eben so stark durchgesetzt ist und da geht man eben viele Partnerschaften ein, auch mit zweifelhaften Akteuren. Auch mit diktatorischen Regimen, die dann eben auch sehr zweifelhafte Mittel einsetzen, um diese Art von Kontrolle durchzusetzen. Und dann wird eben Geld bezahlt, dann wird Technologie bezahlt, einfach, dass dort eben die Grenzen aufgerüstet werden. Ich habe jetzt gerade zwei Mitarbeiterinnen, die in ECOWAS-Forschung machen, da vor Ort, auch zur Rolle der Europäischen Union, um dann überhaupt die politischen Akteure, die Regierung dort, die staatliche Verwaltung zu ermächtigen und in die Lage zu versetzen, bestimmte Arten von Grenzkontrolle durchzuführen. Ganz zentral ist da die Technologie. Also Länder wie Senegal werden von der Europäischen Union finanziert und finanziell unterstützt, dass biometrische Erfassung der eigenen Bevölkerung stattfindet. So, dass die wieder klassifizieren können zwischen denjenigen, die sich eigentlich regulär dort aufhalten, und denjenigen, die möglicherweise auf dem Weg nach Europa sind. Und solche Formen der Verlagerung von Grenzkontrolle und auch von Verantwortlichkeiten, die sprechen eigentlich dafür, dass eigentlich die Grenze, die klassische staatliche Grenze sich doch irgendwie verändert hat zu einer globalisierten Grenze.
Christian, ich glaube, dir brennt eine Frage auf den Nägeln.
Nein, keine Frage, aber, nur im Anschluss: Und da stellt sich dann eben auch die Frage, welche Interessen sind da im Spiel? Also wer verdient zum Beispiel an diesem ganzen biometrischen Apparat und den ganzen sozio-materiellen Apparat, wie man es auch nennt, mit? Diese ganze Industrie, die dahinter steht. Und auch die Frage, jene Länder, die ihre Grenzen externalisieren oder outsourcen, wie ich so gerne auch sage: Die können ja, das haben Sie genau richtig gerade gesagt, sie können ja gar nicht sicherstellen, dass dort auch Menschenrechte respektiert werden und eingehalten werden. Also man gibt da Dinge aus der Hand, weil man es kann in dem Moment, definitiv. Aber ich finde, eine ganz große Leistung von dem Buch ist es, dass es endlich mal auch in einer deutschen Publikation, das muss man ganz klar sagen, eine deutsche Publikation in einer super zugänglichen Sprache mit diesem traditionellen Grenzverständnis bricht. Und das, was Sie was ja auch gesagt haben, dass Grenzen eher so eine, dass wir das heute begreifen müssen, als eine große… Es wird immer gerne der Begriff des Regimes benutzt. Man kann auch als eine Formation oder als ein Ensemble und das ist ja ein Ensemble von Akteuren, als ein Ensemble von Praktiken, als ein Ensemble von Wissen auch usw. So muss man das, glaube ich, viel mehr verstehen. Und genauso ist das Buch auch angelegt. Wir haben in der Grenzforschung viele Begriffe. Wir arbeiten über die Idee der Textur, dass eine Grenze eine Textur von etwas sei, wir haben über Komplexitäten auch in dem Zusammenhang gesprochen. Und Sie bringen aber in Ihrem Buch einen Begriff, der mich sehr begeistert hat, dass Sie denn gebracht haben. Weil ich hatte den auch schon mal irgendwo gelesen und dachte wie dunkel: Das kann man vielleicht auch nutzbar machen, um Grenze zu denken, habe aber die Idee dann nicht weiterverfolgt, wie das so ist. Aber Sie haben das aufgegriffen und zwar ist das die Polykontexturalität. Klingt jetzt erst mal abschreckend, der Begriff. Sie kommentieren das auch entsprechend an der Stelle im Text, aber das finde ich wirklich spannend. Und wenn ich es richtig verstanden habe mit dieser Idee der Polykontexturalität der Grenze, soll das gefasst werden, was sie eben sehr illustrativ erläutert haben, was eigentlich alles an so einem Zaun dranhängt. Vielleicht können Sie das noch mal irgendwie umreißen, weil das finde ich wirklich spannend und das bringt uns, glaube ich, weiter, um Grenzen zu denken heute.
Ja, das ist schon die Vorstellung, dass Grenzen sozusagen kein einheitlicher Monolith sind. Also weder räumlich noch im Hinblick auf die Akteure noch im Hinblick auf die genutzten Technologien. Und dass sie eben nicht nur an dem Ort stattfinden, wo sie stattfinden, sondern dass sie mehr oder weniger wie in konzentrischen Kreisen von ganz, ganz vielen Dingen überlagert sind. Textur ist sicherlich auch ein guter Begriff, den man da nehmen könnte, weil es kommen ja ganz viele Dinge zusammen. Es kommt eben dieses Materielle, dieses Infrastrukturelle zusammen. Es kommt das Rechtliche zusammen, es kommt Personal zusammen, es kommen natürlich auch Grenzdiskurse zusammen. Es kommen natürlich auch die Migrantinnen und Migranten oder die mobilen Personen als Handelnde, als politische Subjekte, als Akteure zusammen. Also die Grenze ist letzten Endes ein Knotenpunkt, wo sich ganz vieles findet, aber dann doch wieder kein Knotenpunkt, weil es eben nicht an einem Ort mehr so stark gebündelt ist. Und deswegen fällt es uns häufig auch schwer, die Grenze überhaupt zu erkennen, wenn wir die Grenze überschreiten. Also man könnte ja sagen, jetzt fahr ich von Deutschland nach Frankreich und wir leben doch in einer entgrenzten Welt. Nichts hat stattgefunden. Ich hab zwar einen Flieger betreten, aber ich muss noch nicht mal meinen Ausweis zeigen. Ein innerdeutscher Flug sieht nicht anders aus. Aber natürlich ist das polykontextural, weil ganz viel anderes stattfindet. Weil Leute frieren an der Grenze; jetzt, die Tage vielleicht nicht. Aber im Winter haben sie gefroren, an der Grenze zwischen Polen und Belarus, weil es eine europäische, nasse Grenze im Mittelmeer gibt. Weil die Türkei-Griechenland Grenze extrem hochgerüstet ist, oder die zwischen Ungarn und Serbien. Das gehört alles mit dazu, wenn wir innerhalb von Europa mobil sind. Ich will das jetzt nicht steigern, in diesem politischen Diskurs zu sagen: Ja, der Schengenraum ist nur möglich, wenn es auch harte Außengrenzen gibt. Das gibt es ja auch, und das hört man im politischen Kontext sehr häufig. Ich denke, die Beziehung ist eigentlich lockerer. Das ist auch viel politischer Wille, der da drinsteckt. Aber natürlich, jede einzelne Grenze ist aus sich heraus gar nicht mehr zu verstehen. Die deutsch-französische Grenze oder die deutsch-polnische Grenze ist nicht mehr zu verstehen ohne die ungarisch-serbische, ohne den ungarisch-serbischen Grenzzaun. Und das ist eben Polykontexturalität. Also man kann aus der einzelnen Grenze gar nicht mehr so viel lernen, sondern muss immer auf sozusagen großflächigere Grenzarrangements gucken und auch zum Teil auf Kaskadengrenzen. Also so nenne ich das, wenn man jetzt die Balkanroute sich anschaut. Das ist ja letzten Endes ein Hindernislauf, der beginnt eben an der Grenze zwischen Türkei und Syrien, und so weiter geht das über ganz, ganz viele Einzelgrenzen. Aber an der allerletzten Grenze sieht man eben am wenigsten. Weil die hat diese ganz vielen Ringe um sich herum, sozusagen andere Typen von Schutzwall oder von Barrierewirkung, die dann mobilisiert werden und die dann dazu führen, dass man im Inneren so tun kann, als lebte man in einer… Ja, die EU hat diesen sehr witzigen Begriff "in dem größten mobilitätsfreien Raum", so heißt das tatsächlich in der deutschen Übersetzung. Aber gemeint ist natürlich in dem Raum, in dem Mobilität möglich ist. Aber sie nennen das mobilitätsfreien Raum, was so ein bisschen paradox ist.
Ja, ergänzend dazu vielleicht, oder…
In dem Zusammenhang wollte ich nur darauf hinweisen, weil, ich glaube, wir fast alle das gar nicht wahrgenommen haben: Gestern war ein Jahrestag der Schengener Abkommen. Vor 38 Jahren wurden die Schengener Abkommen unterzeichnet, die ja uns Europäer*innen das Privileg geben, im Schengenraum frei zu reisen. Und ich habe mich gestern gefragt: Warum wird in den Medien nicht darüber berichtet?
Es kam etwas gestern im Radio.
Ja, ich habe auch vereinzelt was gesehen, aber ehrlich gesagt, ich habe wirklich mit mehr gerechnet. Also gerade auch in Luxemburg, die immer sehr stark an grenzüberschreitenden Themen sind, weil das Land so klein ist usw. Ich war erstaunt, dass da recht wenig Öffentlichkeit war. Aber vielleicht hat das mit dem, was wir gerade diskutiert haben, zu tun. Mit diesem langen Schatten der Migration bzw. dieser Kehrseite, die den Menschen offenbar ist, im Moment, aber die man vielleicht öffentlich nicht so ins Bewusstsein rufen möchte.
Dass man die Grenze als Drama erlebt. Gestern war ja auch das Kentern von diesem Boot mit 700 Migranten und das stand im Vordergrund wahrscheinlich auch.
Ja, ich war im letzten Jahr bei einer Gedenkveranstaltung auch zum Jahrestag des Mauerbaus. Und natürlich, 150 Menschen sind an der innerdeutschen Grenze - die genaue Zahl ist umstritten - gestorben. Aber wir haben eben 20.000 Menschen, die auf der Mittelmeergrenze oder auf dem Weg zum Mittelmeer seit 2014 umgekommen sind. Und da habe ich auf der Veranstaltung auch gesagt: Natürlich, das ist nicht Schießbefehl, das ist auch nicht sozusagen eine Einschlussgrenze. Und wir reden, das ist ja eine Ausschlussgrenze, aber es ist eben auch eine sehr tödliche, sehr mörderische Grenze. Und jetzt auch dieser jüngste Fall. Da ist ja noch in der Diskussion, welche Rolle hat da die griechische Küstenwache gespielt? Haben die denen hinreichend geholfen oder haben die die weggeschickt? Das ist ja jetzt noch in der Diskussion. Aber wir haben eben viele Fälle, wo auch Pushbacks dazu geführt haben, dass Menschen ihr Leben verloren haben, weil die Boote dann danach gekentert sind oder die Luft nicht gehalten hat. Es sind schon extreme… Also ich meine, auch gerade sozusagen vor dem Hintergrund der deutschen Erfahrung mit so einer brutalen innerdeutschen Grenze, denke ich, müsste man eigentlich viel mehr Sensibilität dafür haben, dass solche Problematiken auftauchen. Ich habe in dem Buch ja keine Lösung. Ich habe auch selber keine Lösung darüber, wie man diese Migrationsfrage überhaupt hinreichend beantworten kann. Das ist ja gesellschaftlich sehr kontrovers und Gesellschaften sind offensichtlich auch nur in begrenztem Maße aufnahmebereit. Auch die politischen Diskurse haben sich stark verschoben. Es gibt eben auch eine rechtspopulistische Mobilisierung, die sich an der Grenze aufhängt. Wir selber haben auch Forschung gemacht in Ungarn, und eine Mitarbeiterin hat mir dann Fotos mitgebracht von großen Plakaten, die in Ungarn an diesem neuen Grenzzaun stehen. Und da steht drauf: "Bitte geht wieder nach Hause. Wir wollen euch hier nicht haben." Eine Botschaft von Viktor Orbans Partei. Aber nicht in Englisch oder in Farsi, sondern in Ungarisch. Ja, warum? Es ist ja eine innenpolitische Botschaft und auch nicht gerichtet sozusagen Richtung der Grenze, sondern ins Inland gerichtet. Es ist natürlich eine politische Botschaft, weil man über solche Grenzpolitiken auch eine Art von kollektiver Psychologisierung betreiben kann oder eine Art von Wir-sie-Dichotomie. Da geht es ja auch immer darum, um die Grenze. Also wenn Donald Trump da wie so ein Verrückter irgendwie fordert, die Mexikaner sollten sechs Milliarden Dollar bezahlen, um die Grenze, die sie ausschließt, selber zu finanzieren und sonstiges. Das hat natürlich eine unglaublich starke Mobilisierungsdynamik im Inneren und eine Grenze, vor allen Dingen eine Mauergrenze, hat ja diese paradoxen Wirkungen, dass sie einerseits ein Schutzgefühl vermittelt, aber auch ein extremes Gefühl von Unsicherheit. Also es gibt Studien dazu. Leute, die sich sehr hohe Zäune um ihre Grundstücke bauen, die beklagen das manchmal, dass sie dann immer das Gefühl haben, dahinter ist irgendwie eine andere Welt, die bestimmte Bedrohlichkeiten und bestimmte Gefahren beinhaltet. Und in dem Moment, wo sie das bauen, wird dieses Gefühl eigentlich stärker. Man baut es dagegen, aber es nimmt dann nicht so richtig ab. Man fühlt sich sicher und unsicher zugleich. Und so ist es häufig dann auch für solche Grenzen. Also die machen irgendwie psychisch mit einem etwas.
Das gibt vielleicht die Gelegenheit zu einer letzten Frage, bevor wir dann gern auch noch mal die Möglichkeit geben, Fragen aus dem Publikum zu stellen. Oder Sylvie möchte auch noch…
Ja, ich möchte gerne noch was sagen.
Dann bitte sage das.
Weil wir beim Verdienst vom Buch waren. Christian hat dies gesagt. In der Grenzforschung haben wir lange, glaub ich, um zwei Sachen gekämpft. Methoden - Wie geht man methodologisch an diese Problematik heran? Weil wir ja auch interdisziplinär arbeiten und aus ganz unterschiedlichen Wissenschaften an die Thematik herangehen. Und da ging es darum, ja, wie bündelt man das? Wie kommt man da aus diesen verschiedenen Perspektiven zu diesem Objekt? Und das andere war die Sprache, die Begrifflichkeit. Und ich glaube, ein großes Verdienst von Ihrem Buch ist, dass Sie Begrifflichkeiten liefern, die aus diesem Wirrwarr an Ansätzen, auch an methodologischen Ansätzen, Schlüsselbegriffe geben, die weiterhelfen, weil sie zum einen nicht total wissenschaftlich belastet sind, sehr interdisziplinär anwendbar sind. Und sie kommen zwar aus der Soziologie, aber da gibt es einige Ansätze, die ich zum Beispiel auch für meinen Bereich gut anwenden könnte. Christian hat ein Beispiel gegeben. Man könnte noch viele andere geben. Ein Stichwort ist zum Beispiel auch, Sie sagen, wir sind von der Personengrenze zur Grenzperson gekommen. Das finde ich, ist auch so ein Begriff, der sehr weiterhilft, weil er sehr prägnant ist, sehr ausdrucksstark. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, ist ihr letztes Kapitel sehr, sehr hilfreich. Einfach, wie diese Sprache, die Sie da auch - diese Begrifflichkeiten, die Sie da schaffen.
Sie dürfen gern aufs Lob reagieren.
Ja, das höre ich natürlich gern, das ist klar. Das Buch ist ja für ein Publikum geschrieben. Also nicht alles, was da drinsteht, ist jetzt wissenschaftlich. Sozusagen bin ich nicht der Erfinder davon, sondern es baut natürlich auch auf viel Forschung auf, die vorhanden ist, aber auch auf eigenen Forschungen. Als Versuch, das aber letzten Endes prägnant zu bündeln und ein bisschen auf den Begriff zu kommen und vielleicht auch aus bestimmten wissenschaftsinternen Diskursen, die man hat, ein Stück weit auszubrechen. Also wirklich zu sagen okay, jetzt schlage ich hier mal den Pflock ein und sage, dass es so ist. Auch diese Frage sozusagen der Globalisierung von Mobilität und Immobilität, auch das gibt es bei Zygmunt Bauman als sozusagen rhetorische Figur schon und da habe ich mich natürlich auch dran orientiert. Aber mein Versuch war schon, letzten Endes doch noch mal ein zugespitztes Argument zu präsentieren, möglichst viel, auch unterschiedliche Empirie dazu zu nehmen und mein Kernthema. Es gibt viele andere Dinge auch, die sich mit Grenzzonen und Grenzräumen verbinden, aber mein Kernthema ist schon sozusagen die Reorganisation von Grenzkontrolle. Das ist eigentlich das, worum es mir ganz zentral geht. Ich rede ja auch nicht über Grenzkonflikte und sonstiges. Und wenn man sich das so anschaut, dann sieht man eben, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt in dem Buch, zum Beispiel die Wiederkehr der Mauer. Also dass man Ihnen sagt, die Mauergrenze ist eigentlich etwas, was erst in den 90er Jahren angefangen hat. Wir verbinden das mit den 80ern oder den 50ern und 60ern, aber es gab ganz wenig Mauergrenzen weltweit gerade mal fünf Prozent aller Grenzen. Jetzt sind wir heute bei 22% aller Landgrenzen, weltweit, sind Mauergrenzen. Das ist eine enorme Entwicklung, die da stattgefunden hat. Wir wissen immer Einzelfälle und wissen, dass es überall stattfindet. Vor 15 Jahren bin ich in Brüssel mal gewesen bei einer Konferenz. Da habe ich auch von der Festung Europa gesprochen. Da meinten sie: Ja, das ist doch so ein ideologisierter Begriff, den sollte man vielleicht in einem wissenschaftlichen Diskurs nicht nehmen. Wenn man heute guckt, die einzige europäische Außengrenze, die nicht fortifiziert ist, ist die zwischen der Ukraine und den europäischen oder EU-Nachbarländern. Finnland, Russland, Polen, Belarus usw., alles in den letzten Jahren entstanden. Und heute muss man auch wissenschaftlich, auch politisch, denke ich, mit Fug und Recht von einer Festung Europa sprechen.
Dann stelle ich doch meine letzte Frage. Also ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig und Einigkeit ist schön, aber ich würde gern das Geschäft noch mal ein bisschen aufmischen. Ich kann mich den lobenden Worten nur anschließen. Ich habe Ihr Buch auch mit großem Gewinn gelesen und wirklich sehr geschätzt, dass Sie es geschafft haben, auf hohem wissenschaftlichen Niveau zu argumentieren und gleichzeitig nicht das machen, was viele Soziologen und Soziologen machen. Nämlich Soziologendeutsch zu produzieren, das man doch nur mit mehr oder weniger Lust liest. Es ist ein wirklich toll geschriebenes Buch, das man nicht, weil es so kurz ist, sondern weil das so spannend geschrieben ist, mit Freude von vorn bis hinten durchliest. Ich gebe aber zu, es gibt einen Punkt, wo ich mir ein Kapitel gewünscht hätte. Ein zehntes Kapitel, nämlich die Frage, warum viele dieser Dinge, die Sie schildern, so sind, wie sie sind. Und die Frage stelle ich insbesondere an Sie, weil Sie ja gleichzeitig auch Ungleichheitsforscher sind, weil sie sich mit den Spaltungen der Gesellschaft auseinandersetzen. Und ich habe mir die Frage gestellt: Warum kommt das im Buch nicht vor? Gibt es vielleicht gute Gründe oder was würden Sie auf die Frage antworten? Warum wünschen sich denn doch eine ganze Menge von Menschen genau die Sortierfunktion von Grenzen, die Sie kritisieren? Also, vor einigen Jahren hat das ja David Goodhart auf den Begriff der Anywheres und der Somewheres gebracht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass alle unsere relativ negative Vision von Grenzen teilen würden. Ich glaube noch mal, wir hier auf dem Podium sowieso und auch im Saal sind uns da ziemlich einig. Aber das ist ja nicht in der gesamten Gesellschaft so, es gibt ja Menschen, die wünschen sich durchaus noch mehr Grenzen. Und es sind auch nicht nur perfide Politikerinnen und Politiker, die sie manipulieren, sondern ich habe eher den Eindruck, die politische Klasse fühlt sich manchmal sehr unangenehm dazu gedrängt, Entscheidungen zu treffen, die sie eigentlich gar nicht treffen wollen würden. Aber aufgrund des Drucks aus der Bevölkerung sich dann doch gezwungen sehen, sie zu treffen. Also das würde mich noch interessieren. Wie gehen Sie damit um, mit dieser Frage, dass das relativ negative Bild von Grenzen, was eben in dieser globalen Elite herrscht, von großen Teilen der Bevölkerung nicht geteilt wird. Und zwar wiederum nicht nur in Europa, sondern wenn man sich anguckt, wie in Afrika oder in Asien mit der Frage umgegangen wird, ja durchaus auch von der Bevölkerung dort vor Ort.
Ja, es gibt Abgrenzungsbedürfnisse, und ich sage ja, Grenzen haben auch eine Ordnungsfunktion. Es gibt auch positive Leistungen von Grenzen, zum Beispiel wenn wir uns globale Finanztransaktionen anschauen oder andere Dinge, wo wir sagen: Ja, es ist für bestimmte Länder vielleicht gar nicht so einfach möglich, aus einer ökonomischen Position der Benachteiligung herauszukommen, weil sie sofort dem globalen Markt ausgesetzt sind. Also sie können eigentlich kein Binnenmarkt so richtig entwickeln. Dennoch, würde ich sagen, sind diese Sortiermaschinen natürlich so eingerichtet, dass sie bestimmte Menschen begünstigen und andere nicht. Und ich glaube, wenn Sie fragen: Warum möchten so viele Leute Grenzen? Dann kommt es immer darauf an, wen man eigentlich fragt. Und die Begünstigten wollen natürlich keine Grenzen für sich. Der AfD-Politiker oder jemand vom Front national möchte auch nach Mallorca fliegen übers Wochenende, oder nach London oder sonst wohin. Also da geht es ja nicht darum, dass Sie sagen, ich möchte jetzt auf der national gesellschaftlichen Scholle festgesetzt werden. Sondern es geht darum, dass sozusagen bestimmte Entscheidungen zulasten Dritter gefällt werden und die dann ausgeschlossen werden. Und ich habe immer so dieses Bild: Man stellt sich vor, man ist irgendwie Außerirdischer, man bewegt sich auf die Erde zu und dann ist die gesamte Weltoberfläche so in kleine Waben aufgeteilt, das sind die Länder. Und dann kann man sehen, da sitzen dann die Menschen-Bienen da drin. Und dann kann man sehen, dass einige können aus ihrer Wabe raus, die fliegen überall hin und dann fliegen sie manchmal wieder zu ihrer Wabe zurück oder wieder dahin, von Berlin nach Paris oder wo auch immer. Und dann gibt es einige, die kommen aus der Wabe nicht raus. Ja gut, da kann man fragen: Ja, wenn man jetzt diese Bienen, Menschen-Bienen fragen würde, die da in der Wabe festsitzen, würdet ihr dann auch gern mal in eine andere Wabe fliegen? Da würde ich sagen, da sagen die allermeisten: "Ja." Die würden vielleicht nicht sagen, dass ihre Wabe ganz aufhören sollte zu existieren oder ganz löchrig zur Nachbarwabe werden soll. Aber Sie würden sagen: "Ich würde da gerne mal hin." Aber diejenigen, die da herumschwirren, die würden vielleicht sagen: "Diese Bienen, die da… Nein, das wäre mir zu dichter Flugverkehr. Oder dann kommen die noch in meine Wabe und verstopfen die. Das möchte ich natürlich nicht." Und aus der Perspektive eines Außerirdischen ist die Welt eben aufgeteilt in einen Mobilitätsadel, das sind wir, also Leute, die große Privilegien genießen, und vielen, die in ihren Waben inhaftiert sind. Und da würde ich sagen, aus einer Gerechtigkeits-, aus einer normativen Perspektive, aber auch aus einer politischen Perspektive, vielleicht auch aus einer wissenschaftlichen, oder einer gerechtigkeitstheoretischen ist das etwas, was man durchaus mit einem Fragezeichen versehen kann.
Vielen Dank, wunderbar. Und ich gebe sehr gern ins Publikum, wenn Fragen sind. Bitte warten Sie so lange, bis Sie das Mikrofon haben. Weil sonst versteht sie unsere Übersetzerin nicht. Aber dann sprechen Sie gern los.
Ja, Einer muss ja anfangen. Ich habe eine Frage, vielleicht auch in Verbindung von dem Buch, jetzt unserem Lütten, Kleinen auch. Wir haben ja momentan wieder die große Diskussion in Deutschland über Ost-West, Ost-, Westdeutschland, wo ja auch sozusagen sortiert wird, wer ist Ossi, wer ist Wessi. Also so kann man es auch auf diese Begrifflichkeit bringen. Meine Frage ist eigentlich nur, wie Sie das momentan wahrnehmen und wie Sie das sozusagen in Ihre Sortiermaschine integrieren.
Ja, in die Sortiermaschine kann ich das kaum integrieren. Aber ich habe mich jetzt sozusagen aus diesen öffentlichen Diskussionen zu… Es geht ja hauptsächlich um zwei Bücher, die da eine bestimmte Art von Brisanz in die öffentliche Debatte gebracht haben. Von Herrn Oschmann und von Katja Hoyer über sozusagen eine Art von Alltagsgeschichte der DDR. Aber das Buch habe ich gar nicht gelesen, weil ich habe immer das Gefühl, ich war ja dabei, ich muss das jetzt nicht noch mal nachlesen und Zeit damit verbringen. Ich bin da gegenüber vielem, was sozusagen da in der öffentlichen Diskussion zumindest hochschwappt, bin ich auch skeptisch. Und das ist mir zum Teil auch über-politisiert. Herr Oschmann hat allerdings einen interessanten Punkt. Mir begegnet das immer wieder; ich war gestern in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zu einer Podiumsdiskussion. Da ging es um 30 Jahre Akademiegründung, aber auch noch mal um die Frage der Abwicklung der DDR-Institution Wissenschaft, auch der, sozusagen der Evaluation von ostdeutschen Wissenschaftlerinnen. Bei diesen Evaluationskommissionen sind viele Hunderte Institute, oder 130 oder so evaluiert worden, 90% kamen eben aus dem Westen. Und hinterher, ich habe das auch so ein bisschen kritisiert, hinterher kamen dann Leute irgendwie so: Ost und West gibt es doch gar nicht mehr, ist ja nicht existent.
Das waren ganz sicher nahezu ausschließlich Westdeutsche, oder?
Und da hat, Herr Oschmann schreibt in seinem Buch, und das finde ich eine interessante Beobachtung: "Wenn Sie in der Zeitung etwas über Ossis lesen oder so etwas, was der Vorstand von Springer, Herr Döpfner, geschrieben hat, also über die Ostdeutschen, wenn Sie das lesen und Sie fühlen sich selbst gemeint, wenn von Ossis die Rede ist, dann sind Sie einer. Wenn Sie sich nicht selbst gemeint fühlen, dann sind Sie keiner." Und das stimmt in gewisser Weise. Herr Diekmann oder Herr Döpfner wohnen natürlich seit 25 Jahren in Ostdeutschland, in Potsdam. Aber die würden natürlich niemals sich als Ossi bezeichnen. Die reden zwar über Ossis, aber dann sind immer die anderen gemeint. Und wir haben in einer eigenen jüngeren Studie mal gefragt: Gibt es überhaupt Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen? Eine repräsentative Befragung. Da sagen 65% der Ostdeutschen: "Ja, die gibt es." 30% der Westdeutschen sagen: "Ja, die gibt es." 70% sagen: "Die gibt es nicht." Das heißt eigentlich, dass es so etwas gibt wie eine Negation von Alterität. Also die Westdeutschen sehen diese Unterschiede gar nicht. Und die sagen: "Ja, wovon redet ihr denn eigentlich? Wir sind doch alle gleich." Und die Ostdeutschen sehen das. Und das Interessanteste an dieser Studie ist eigentlich, wenn man mal guckt, wie ist das eigentlich über das Alter verteilt? Dann sieht man, dass diese Alten-Generation, Leute über 70, für die ist natürlich das, die Blockkonfrontation und die deutsche Teilung, noch sehr präsent. Da sagen auch im Westen sehr viele, es gibt Unterschiede zwischen Ost und West. Bei den Leuten unter 25 sagen das nur noch knapp über 10%. Für die ist es ein nicht existentes Thema. Bei den Ostdeutschen gibt es überhaupt keine Veränderung über das Alter. Ob sie über 70 sind oder unter 25, die Zustimmungsraten sind die gleichen. Ich habe das jetzt noch nicht entschlüsselt, aber es ist ein sehr interessantes Phänomen, dass offensichtlich für einen Teil der Ostdeutschen diese Differenzierung zwischen Ost und West nach wie vor eine Rolle, jedenfalls eine kognitive Rolle spielt. Vielleicht nicht mit einer starken Ostidentität usw., aber irgendwie eine Erfahrungsschicht, die eine Rolle spielt, aber für die Westdeutschen eigentlich das ein verschwindendes Thema ist. Und das macht es so schwer, öffentlich darüber überhaupt einen Diskurs zu führen, weil die eine Seite gar nicht weiß, wovon die andere eigentlich redet, auch gar nicht das thematisieren möchte. Das beantwortet Ihre Frage nicht ganz genau, wie das mit den Sortiermaschinen zusammenhängt. Aber es gibt offensichtlich, das geht auch auf Ihre letzte Frage, es gibt offensichtlich auch menschliche Bedürfnisse nach Differenzbildung. Georg Simmel sagt: "Der Mensch ist ein Unterschiedswesen." Also er macht Unterschiede, er ordnet sich zu, er klassifiziert. Wir machen das schon, um unsere auch soziale Welt irgendwie zu strukturieren und zu erkennen. Und Identität ist eben sozusagen ein Teil dieser Zuordnungsleistung. Und Grenzen sind dann vielleicht eine Form von Materialität oder eine Form von Politik, um die noch mal zusätzlich zu manifestieren. Deswegen werden Grenzen auch nicht völlig überflüssig werden. Aber man kann natürlich trotzdem Fragen an Grenzen stellen, vor allen Dingen, wenn Grenzen mit großen Ungerechtigkeiten und auch mit starken sozialen Schäden verbunden sind. Da habe ich jetzt noch ein bisschen die Kurve gekriegt.
Na ja, vielen Dank. Also ich meine, man kann das ja vielleicht noch, wenn ich mir das erlauben darf, noch weitertreiben. Also, Sie gehen ja dann offensichtlich eben auch… Also, es gibt nicht nur ein Bedürfnis nach Unterschieden und nach Alterität. Sondern es gibt halt tatsächlich auch offensichtlich ein Bedürfnis nach Abschließung. Denn eines der Hauptargumente von Oschmann, dessen Buch ich auch mit großem Gewinn gelesen habe, aber das vielleicht an mancher Stelle ein bisschen übers Ziel hinaus schießt und ja auch ganz offensiv sagt, es ist ein Pamphlet. Aber eines der Argumente von Oschman scheint mir nicht von der Hand zu weisen zu sein, nämlich dass Ostdeutsche einfach unterrepräsentiert sind, und zwar ganz massiv unterrepräsentiert sind. Und da sind wir dann, glaube ich, schon in einer ähnlichen Thematik. Da geht es natürlich nicht über Kontrollen am Flughafen, sondern da geht es um Kontrollen, um soziale Kontrollen, um Zugangsbarrieren zu bestimmten sozialen Milieus. Und dann eben doch auch wieder um eine Art von Sortiermaschine, die eben nicht an Zäunen stattfindet oder in Afrika, sondern in diesem Fall mitten in Deutschland.
Ja, es ist sicherlich so, Sie haben das ja zu Anfang erwähnt. Wir sprechen heute nicht über Ostdeutschland, jetzt doch ein bisschen. Aber es sind drei Ostdeutsche auf dem Podium, das ist auch sehr selten. Ich war neulich bei Anne Will, einer deutschen Talkshow im Fernsehen. Da ging es auch gar nicht um Ostdeutsche. Und da waren wir in der Mehrheit auch Ostdeutsche, was sehr interessant war. Und da haben die Macher der Sendung hinterher gesagt, das gab es eigentlich noch nie. Das gibt es nur, wenn zu spezifisch ostdeutschen Themen diskutiert wird. Also es ist wirklich eine große Ausnahme gewesen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es in der Sendung auch mal Ostdeutsche eine Rolle spielte, aber wenn, dann jedenfalls nicht die zentrale.
Also dann, sehr schön, dann haben wir heute auch eine Premiere. Denn es ging ja tatsächlich auch eigentlich nicht um Ostdeutschland. Aber gern noch eine letzte Frage aus dem Publikum, bevor wir dann unsere Übersetzerin entlasten.
Vielen Dank für diese spannende Diskussion. Ich habe auch eine Frage zu den anderen Typen, anderen Arten von Grenzen. Sie haben viel von politischen Grenzen gesprochen. Aber es gibt noch andere Grenzen wie Sprachgrenzen und wirtschaftliche Grenzen, die manchmal auch schwieriger zu überschreiten sind. Also was meinen Sie über diese Grenzen, die es auch in Europa gibt, zum Beispiel in Belgien oder in der Schweiz, die manchmal auch vielleicht relevanter sind als die politischen Grenzen, also die staatlichen Grenzen.
Ja, ich habe im Prinzip nur auf einen Typus geguckt. Die englische Sprache hat leider einen großen Vorteil, hat eben diesen Unterschied zwischen borders und boundaries. Und im Deutschen haben wir das nicht so, ich weiß nicht, ob es das im Französischen gibt. Aber um zumindest zu unterscheiden zwischen sozusagen klassischen, häufig auch territorial verstandenen Grenzen und dann sozialen, moralischen und auch kulturellen Grenzen - sie spielen natürlich eine große Rolle, die sind auch nicht immer deckungsgleich. Bestimmte Spannungen resultieren auch daraus, dass sie nicht ganz deckungsgleich sind. Und offensichtlich haben soziale Gemeinschaften oder soziale Gebilde auch immer ein großes Interesse daran, auch diese Typen von Grenzen aufrecht zu erhalten. Also in der Geschichte geht das ja hin bis zu sehr strengen Heiratsregeln, nur innerhalb der gleichen religiösen oder linguistischen oder ethnischen Gruppe und sonstigen Dingen. Also sozusagen, dass diese Assoziationsinteressen von Menschen, also sich mit anderen in Beziehung zu setzen und von anderen zu dissoziieren, also von ihnen sich irgendwie zu trennen. Das scheint etwas zu sein, was sehr wichtig ist. Das hat natürlich auch wieder was mit der Identitätsfrage zu tun. Leute haben Erfahrungsschichten, haben sozusagen Herkünfte, die nicht so ohne Weiteres austauschbar sind. Also man sagt zwar, Identitäten pluralisieren sich jetzt und ist frei wählbar usw., aber so frei wählbar sind sie letzten Endes dann doch nicht, weil man immer wieder darauf zurückgeworfen wird. Also selbst wir drei jetzt auf diesem Podium heute Abend werden ja in gewisser Weise auch wieder auf diese Identitätsfrage zurückgeworfen. Und warum ist das so? Ja, natürlich, weil Identität auch etwas mit Formen des kollektiven Selbstwertgefühls zu tun haben. Weil sie natürlich etwas mit sozialen Erfahrungen zu tun haben, die auch nicht austauschbar sind. Und weil sie natürlich auch eine Art von biografischer Stabilität vermitteln. Also, "Wer bin ich?" hat auch immer etwas damit zu tun: "Zu wem gehöre ich eigentlich?" Das lässt sich nicht vollständig auslösen und deswegen ist es auch nicht völlig irrelevant, wo man herkommt. Deswegen treffen sich häufig Gruppen von Ähnlichen oder Gleichen in völlig anderen, unterschiedlichen sozialen Kontexten immer wieder und finden das sogar ganz erfreulich, weil sie dann in den Leuten Dinge wiedererkennen. Und es ist immer ganz interessant. Es gibt ja auch Studien dazu, also zu Inter-Gruppenkontakten und so und dann sieht man immer, dass Leute woanders hingehen. Die gehen dann irgendwie als Studierende nach England und nach vier oder fünf Wochen, wenn man die dann interviewt, dann sagen sie, die sind ja genau wie wir. Es gibt ja keinen Unterschied. Und dann interviewt man dieselben Leute noch mal 12 Monate später, und dann sagt man, so ein bisschen komisch sind die Engländer doch. Dann stellt man plötzlich, werden diese Unterschiede wieder mobilisiert, und dann ist eben doch nicht alles völlig egal.
Sie sagen schon in dem Buch zu den kulturellen Grenzen, "kulturelle Homophilie" nennen Sie das, glaube ich, also eine gewisse Vereinheitlichung auch auf kultureller Ebene. Also das könnte jetzt eine Sprache sein, eine Religion, keine Garantie dafür ist, dass man keine Grenzen aufzieht. Das ist auch ein Paradox ein Stück weit, weil man denken könnte, dass das, was kulturell zusammenhängt, eigentlich dann auch dieses Bedürfnis nicht hat oder weniger hat.
Jetzt haben wir mit der Dialektik Öffnung-Schließung begonnen, hören mit dem Paradox der kulturellen Gleichheit-Ungleichheit auf. Vielen herzlichen Dank an alle für das Kommen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass das tolle Buch von Stefan Mau draußen vor dem Saal sehr gern käuflich erworben werden kann. Ich danke sehr herzlich unserer Simultanübersetzerin Cornelia Geiser für die Arbeit. Ich glaube, dass ist einen Applaus wert.
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
LÜTTEN KLEIN : VIVRE EN ALLEMAGNE DE L'EST. UNE SOCIÉTÉ EN TRANSITION
MauSteffenParution de l'ouvrage de Steffen Mau Avec Lütten Klein, Steffen Mau offre un livre aussi personnel qu'instructif. Son étude, rédigée avec beaucoup d'empathie, repose sur
-
Penser en langues | In Sprachen denken - Martina Löw
LefeuvreMarie-PierreBretschneiderFalkBourdinAlainRenaultDidier2ème rencontre franco-allemande de traducteurs en sciences humaines et sciences sociales 14, 15 et 16 mars à Paris Organisée par les Editions Maison des sciences de l'homme, la 2ème
Sur le même thème
-
La frontière chiites/sunnites au Moyen-Orient
BrombergerChristianChiites, sunnites, comment sont nées ces deux branches de l’Islam ? Qu’elles sont aujourd’hui leurs particularités et leurs relations dans les domaines très divers, activités religieuses, croyances,
-
La Génération Windrush : "Dans quelle mesure les frontières et les déplacements, à travers l'histoi…
JadeLamiaFrontière(s) et déplacement(s) – Journée d’étude Master Études Culturelles et Linguistique
-
Frontières sociales et errance identitaire : analyse de La Faim de Knut Hamsun (1890) et son adapta…
JeffredoPaoloVatinelMarineFrontière(s) et déplacement(s) – Journée d’étude Master Études Culturelles et Linguistique
-
-
La Réunion d'aujourd'hui, quels défis?
BrialFabienBrunet-MalbrancqJoëlleLes causeries de la géographie - Les cartes 4
-
L’espace liminal. Frontières et énonciation dans « Les Lumières d'Oujda » de Marc Alexandre 0ho Bam…
BouabibMyriam« Dedans / Dehors » « GlobalMed – La Méditerranée et le monde de la Préhistoire à nos jours. Approches interdisciplinaires et internationales » 2e rencontre du réseau GlobalMed Maison
-
JRSS 2022 - Dynamique des espaces ruraux, regard sur 40 ans de recherche en économie et en sociolog…
SchmittBertrandBertrand Schmitt porte son regard sur 40 ans de recherche en économie et en sociologie... « rurale » autour de la dynamique des espaces ruraux.
-
Les découpages du monde - Cycle « La fin des frontières ? » 2012
GrataloupChristianNotre rapport au monde et à ses découpages (continents, aires culturelles, frontières, ...) s'inscrit dans une histoire, celle des grandes découvertes européennes.
-
La Chine et ses frontières maritimes
ColinSébastienSorelJean-MarcCycle « La fin des frontières ? » 2012 Barrière épaisse ou ligne imaginaire, la frontière regroupe autant qu'elle disperse peuples et territoires. Les dynamiques impulsées par la mondialisation et
-
À quoi servent les frontières ? Conférence inaugurale par Michel Foucher
FoucherMichelCycle « La fin des frontières ? » 2012 Barrière épaisse ou ligne imaginaire, la frontière regroupe autant qu'elle disperse peuples et territoires. Les dynamiques impulsées par la mondialisation et
-
An «Algerian» Jew in Morocco: A Story of Migration, Deception and Confusion, 1880-1890
MarglinJessica M.Session 5 : Trajectoires / Ruptures Colloque : Migrations, identité et modernité au Maghreb Colloque international organisé à Essaouira (Maroc), du 17 au 20 mars 2010. Ce colloque est une
-
Les Libanais de Galilée: pratique et production d’une frontière israélo-libanaise
SchneidlederAdoramColloque international : 12, 13 et 14 novembre 2009, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Aix-en-Provence Organisé par Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM) et Cédric Parizot (CRFJ,