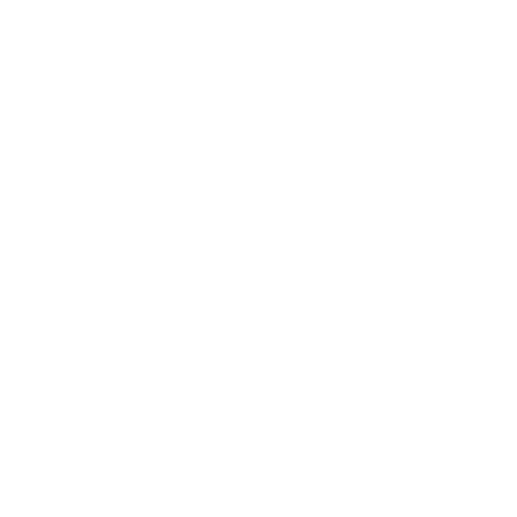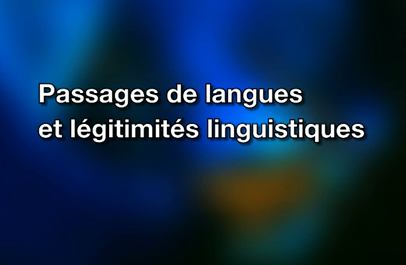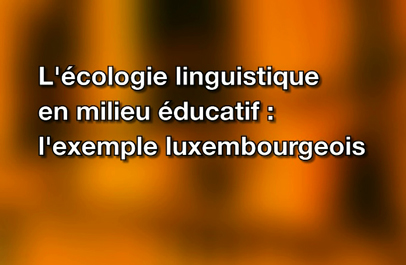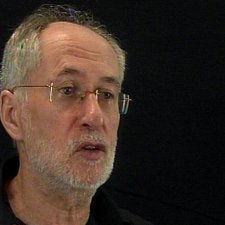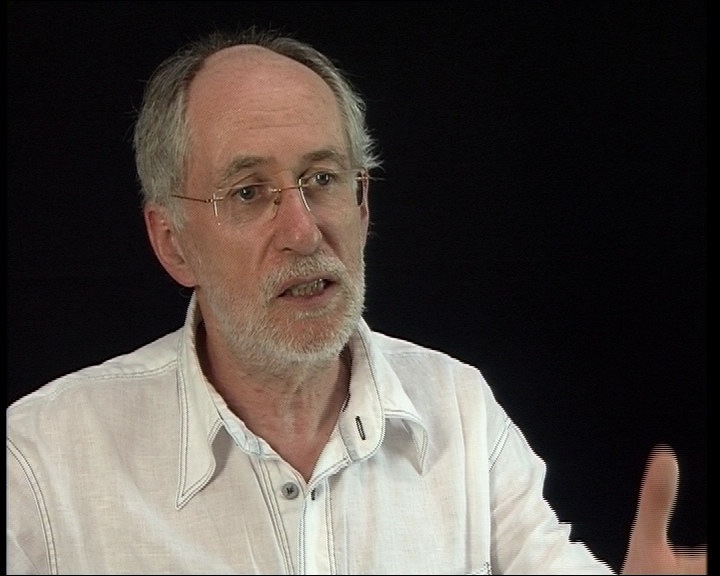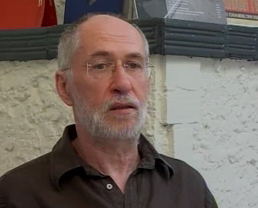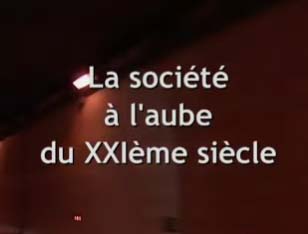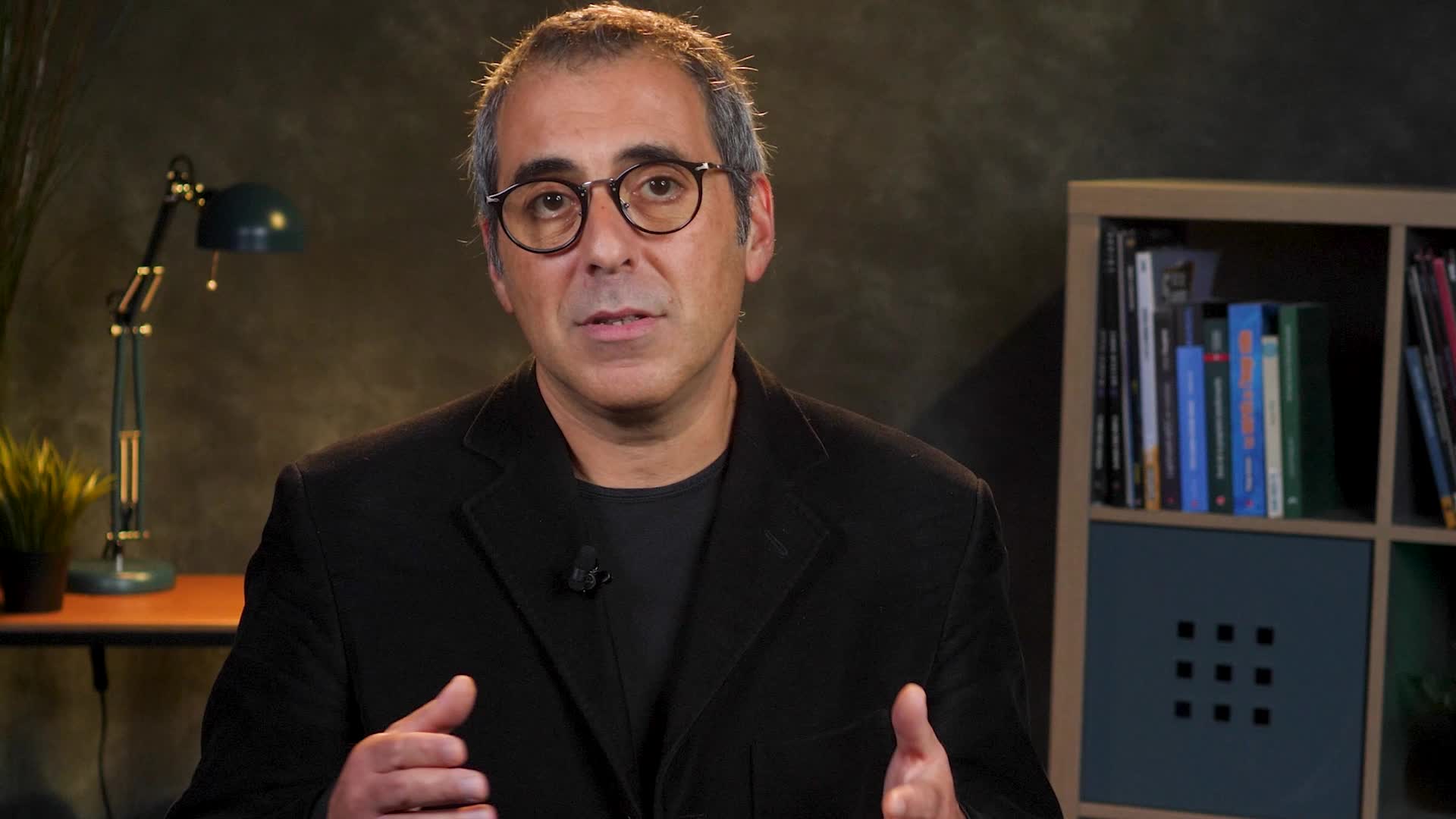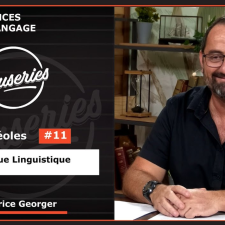Chapitres
- Introduction01'00"
- I. Politiques linguistiques01'30"
- Introduction02'02"
- Eléments, facteurs, acteurs10'46"
- La Sarre, dimension nationale et régionale14'21"
- Dimension européenne02'49"
- II. Notions de linguistique contrastive00'16"
- Systèmes, usages. Comprendre, traduire16'05"
- Politique européenne pour le plurilinguisme07'12"
- Intercompréhension29'35"
- III. Pragmatique et linguistique variationnelle00'05"
- Introduction01'10"
- Analyse du discours29'52"
- Questions interculturelles, les langues des migrants07'59"
- Traditions universitaires / styles d'enseignement / écrire dans une langue étrangère08'26"
- Générique de fin00'19"
Notice
Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (3/3) - Pratiques multilingues à l'université : une approche contrastive
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
« Pratiques multilingues à l'université : une approche contrastive » est la troisième partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme.
Rappelons que le cadre général de cette ressource est le plurilinguisme abordé à partir de plusieurs disciplines. Cette partie a pour objet l’apport des politiques linguistiques et des différentes disciplines de la linguistique à la thématique. Nous allons reprendre comme sujets principaux les politiques linguistiques aux niveaux européen, national et régional, les notions de linguistique contrastive, pragmatique et variationnelle ainsi que le pluri-/multilinguisme, l´enseignement/apprentissage des langues, l´intercompréhension et les différentes traditions universitaires.
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
BIBLIOGRAPHIE,SOMMAIRE
Bibliographie thématique
Pratiques multilingues à l'université : une approche contrastive, proposée par Claudia Polzin-Haumann, Christina Reissner et Elisabeth Venohr
Politique linguistique / Sprach(en)politik, Bildungspolitik
Beacco, J. C./Byram, Michael (2005): Guide for the development for language education policies in Europe: From linguistic diversity to plurilingual education.Strasbourg: Council of Europe, Language Policy Division.
Bochmann, Klaus (ed., 1993): Sprachpolitik in der Romania. Zur Geschichte sprachpolitischen Denkens und Handelns von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart, Berlin/New York.
Braselmann, Petra (1999): Sprachpolitik und Sprachbewusstsein in Frankreich heute, Tübingen.
Calvet, Louis-Jean (1987): La guerre des langues et les politiques linguistiques, Paris.
Caubet, Dominique/Chaker, Salem/Sibille, Jean (2002): Codification des langues de France, Paris.
Cerquiglini, Bernard (ed., 2003): Les langues de France, Paris.
Cichon, Peter (2001): Mehrsprachigkeit als gesellschaftliche Herausforderung. Sprachenpolitik in romanischsprachigen Ländern, Wien.
Conseil d’Europe (1993): „Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Traité et rapports”, Strasbourg, [En ligne]
Conseil d’Europe (2006) : Recommandation du parlement européen et du Conseil, du 18 déc. 2006, sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie [Journal officiel L 394 du 30.12.2006].
Doyé, Peter (2005): „Intercomprehension”, in: Beacco, J.C./ Byram, M.
Europäische Kommission (1995): Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung: Lehren und Lernen. Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft. KOM (1995) 590 vom 29.11.1995, Strasbourg [En ligne]
Europäische Kommission (2008): Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Mehrsprachigkeit: Trumpfkarte Europas, aber auch gemeinsame Verpflichtung . KOM (2008) 566 endgültig [En ligne]
Europarat (1997): Entschließung des Rates vom 16. Dezember 1997 über die frühzeitige Vermittlung der Sprachen der Europäischen Union [Amtsblatt C 1 vom 3.1.1998], [En ligne]
Europarat (2001): The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. www.coe.int/lang (20.09.2011).
Hartmann Berschin, Benno (2006): Sprach- und Sprachenpolitik. Eine sprachgeschichtliche Fallstudie (1789-1940) am Beispiel des Grenzlandes Lothringen (Moselle), Frankfurt am Main u.a.
Hochrangige Gruppe Mehrsprachigkeit (2007): „Empfehlungen für das Sprachenlernen“, [En ligne] (kurze Zsf. auf Deutsch [En ligne])
Kommission der europäischen Gemeinschaften (2003): „MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT, DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN. Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt: Aktionsplan 2004 - 2006“, [En ligne]
Kommission der europäischen Gemeinschaften (2005): „MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT, DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN. Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit“ [KOM (2005) 596 endgültig], [En ligne]
Lefèvre, Amélie (2002): Le statut des langues régionales ou minoritaires en France et en Allemagne, Paris.
Ministerium für Bildung [Saarland] (2011): Sprachenkonzept Saarland 2011, [En ligne]
Polzin-Haumann, Claudia (2006): „Sprachplanung, Sprachlenkung und institutionalisierte Sprachpflege: Französisch und Okzitanisch”, in: Ernst, Gerhard/Gleßgen, Martin-Dietrich/Schmitt, Christian/Schweickard, Wolfgang (edd.): Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen, t. II, Berlin/New York, 1472-1486
Polzin-Haumann, Claudia/Reissner, Christina (2012): „Perspectives du français en Sarre: Politiques et réalités”, in : Cichon, Peter/Ehrhart, Sabine/Stegu, Martin (eds.): Les politiques linguistiques explicites et implicites en domaine francophone.
Putz, Stéphane (2003): La France et les langues régionales ou minoritaires. Pourquoi la France n'a-t-elle pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaire?, Grenoble.
Schmitt, Christian (1998): „Sprachkultur und Sprachpflege in Frankreich”, in: Greule, Albrecht/Lebsanft, Franz (eds.): Europäische Sprachkultur und Sprachpflege, Tübingen, 215-243.
Schmitt, Christian (2000): „Nation und Sprache: das Französische”, in: Gardt, Andreas (ed.): Nation und Sprache: die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart, Berlin, 683-754.
Willy, Armin (2006): Die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen in der Sprachpolitik Frankreichs und der Schweiz, Stuttgart.
Woehrling, Jean-Marie (2005): La charte européenne des langues régionales ou minoritaires: un commentaire analytique, Strasbourg.
Übersicht über aktuelle Entwicklungen in der europäischen Mehrsprachigkeitspolitik [En ligne]
Linguistique contrastive / Kontrastive Linguistik romanisch/französisch-deutsch
Adamzik, Kirsten (ed. 2001): Sprachkontakt, Sprachvergleich und Sprachvariation. Festschrift für Gottfried Kolde zum 65. Geburtstag, Tübingen.
Albrecht, Jörn (1990): „Invarianz, Äquivalenz, Adäquatheit“, in: Arntz, Reiner/Thome, Gisela (edd.): Übersetzungswissen¬schaft. Ergebnisse und Perspektiven, Festschrift für Wolfram Wilss zum 65. Geburtstag, Tübingen, 71-81.
Bausch, Karl-Richard/Gauger, Hans-Martin (edd., 1971): Interlinguistica. Sprachvergleich und Übersetzung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Mario Wandruszka, Tübingen.
Blumenthal, Peter (1987): Sprachvergleich Deutsch-Französisch, Tübingen.
Cartagena, Nelson (2001): „Kontrastive Linguistik. Linguistique contrastive“, in: Holtus, Günter/ Metzeltin, Michael/ Schmitt, Christian (edd.): Lexikon der Romanistischen Linguistik, Bd. I, 2, Tübingen, 687-704.
Clarenz-Löhnert, Hildegard (2004): Negationspräfixe im Deutschen, Französischen und Spanischen: ein Beitrag zur kontrastiven Linguistik, Aachen.
Coseriu, Eugenio (1990): „Science de la traduction et grammaire contrastive“, in: Linguistica antverpiensia XXIV, 29-40.
Filipović, Rudolf (1977): „The use of Contrastive and Error Analysis to Practicing Teachers“, in: Engel, Ulrich (ed.): Deutsche Sprache im Kontrast, Tübingen, 5-22
Fisiak, Jacek (ed, 1984): Contrastive Linguistics. Prospects and Problems, Berlin/New York/ Amsterdam.
Gunkel, Lutz/Zifonun, Gisela (edd. 2012): Deutsch im Sprachvergleich: Grammatische Kontraste und Konvergenzen, Berlin
Henrici, Gert/Zöfgen, Ekkehard (eds.): Fremdsprachen Lehren und Lernen, 24 (Themenschwerpunkt: Kontrastivität und Kontrastives Lernen, koordiniert von Claus Gnutzmann).
Krzeszowski, Tomasz P. (1990): Contrasting Languages. The Scope of Contrastive Linguistics, Berlin/New York.
Lavric, Eva (im Druck): „Article zéro et absence d’article en français et en allemand“, in: Fesenmeier, Ludwig / Grutschus, Anke / Patzelt, Carolin (edd.): Absence(s) – Phänomene sprachlicher Absenz und Möglichkeiten ihrer Analyse, Akten der gleichnamigen Sektion auf dem Frankoromanistentag in Essen, 29.9.-2.10. 2010.
Lavric, Eva/Pöckl, Wolfgang/Schallhart, Florian (eds., 2008): Comparatio delectat: Akten der VI. Internationalen Arbeitstagung zum Romanisch-Deutschen und Innerromanischen Sprachvergleich, Innsbruck, 3. - 5. September 2008, Frankfurt a.M. u.a..
Nickel, Gerhard (ed., 1972): Reader zur kontrastiven Linguistik, Frankfurt a.M.
Osthus, Dietmar (2000): Metaphern im Sprachvergleich. Eine kontrastive Studie zur Nahrungsmetaphorik im Französischen und Deutschen, Frankfurt a.M. u.a.
Polzin, Claudia (1998): Der Funktionsbereich ‘Passiv’ im Französischen. Ein Beitrag aus kontrastiver Sicht, Frankfurt a. M. u.a.
Pietri, Etienne/Fredet, Florentina (eds., 2006): Linguistique contrastive, linguistique appliquée, sociolinguistique, Bern u.a.
Raabe, Horst (ed., 1979): Trends in Kontrastiver Linguistik, Tübingen.
Rein, Kurt (1983): Einführung in die kontrastive Linguistik, Darmstadt.
Rovere, Giovanni/Wotjak, Gerd (eds.): Studien zum romanisch-deutschen Sprachvergleich, Tübingen.
Schmitt, Christian (1991a): „Kontrastive Linguistik als Grundlage der Übersetzungswissenschaft“, in: Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 101, 227-241.
Schmitt, Christian (1991b): „Übersetzen und Kontrastive Linguistik“, in: Ders. (ed.): Neue Methoden der Sprachmittlung, Wilhelmsfeld, 49-83.
Schmitt, Christian (1993): „Ausgangssprachliche Produktivität und zielsprachliche Aktivität in der Wortbildungslehre. Zu den französischen Entsprechungen deutscher Kollektivmorpheme“, in: Mattheier, Klaus u.a. (ed.): Vielfalt des Deutschen. Festschrift für Werner Besch, Frankfurt a.M., 533-549.
Schmitt, Christian (1995): „Übersetzen: Vermittlung und Überwindung von Strukturen“, in: Hirdt, Willi (ed.): Übersetzen im Wandel der Zeit. Probleme und Perspektiven des deutsch-französischen Literaturaustausches, Tübingen, 221-238.
Schmitt, Christian (1997): „Prinzipien, Methoden und empirische Anwendung der Kontrastiven Linguistik für das Sprachenpaar Deutsch/Spanisch“, in: Wotjak, Gerd (ed.): Studien zum romanisch-deutschen und innerromanischen Sprachvergleich. Akten der III. Internationalen Arbeitstagung zum romanisch-deutschen Sprachvergleich (Leipzig, 9.10.-11.10. 1995), Frankfurt a.M. u.a., 9-30.
Schmitt, Christian/Schweickard, Wolfgang (eds., 1995): Die romanischen Sprachen im Vergleich: Akten der gleichnamigen Sektion des Potsdamer Romanistentages (27. - 30.9.1993), Bonn.
Schmitt, Christian/Wotjak, Barbara (eds., 2005): Beiträge zum romanisch-deutschen und innerromanischen Sprachvergleich: Akten der gleichnamigen internationalen Arbeitstagung (Leipzig, 4.10. - 6.10.2003), 2 Bde., Bonn.
Schröpf, Ramona (2011): Die fabelhafte Welt der Untertitelung. Übersetzungsstrategien und kulturbedingte Probleme im Sprachenpaar Französisch – Deutsch, Saarbrücken.
Schwarze, Brigitte (2008): Genus im Sprachvergleich. Klassifikation und Kongruenz im Spanischen, Französischen und Deutschen, Tübingen.
Sõrés, Anna (2008): Typologie et linguistique contrastive. Théories et applications dans la comparaison des langues, Bern u.a.
Soutet, Olivier (ed. 2006): Études de linguistique contrastive, Paris.
Spillner, Bernd (2005), „Kontrastive Linguistik – Vergleichende Stilistik – Übersetzungsvergleich – Kontrastive Textologie. Eine kritische Methodenübersicht, in: Schmitt, Christian/Wotjak, Barbara (eds.), Bd. I, 269-293.
Wotjak, Gerd (ed., 2001): Studien zum romanisch-deutschen und innerromanischen Sprachvergleich. Akten der IV. Internationalen Tagung zum Romanisch-Deutschen und Innerromanischen Sprachvergleich (Leipzig, 7.10. - 9.10.1999), Frankfurt a.M. u.a.
Intercompréhension / Interkomprehension, Mehrsprachigkeit, Mehrsprachigkeitsdidaktik, Identität
Abel, Fritz (2006): „Gemeinsamkeiten im Häufigkeitswortschatz des Französischen, Italienischen und Spanischen. Bericht über ein Experiment“, in: Martinez, H./Reinfried, M. (eds., 2006), 37-52.
Androulakis, G. et al. (2008): Pour le multilinguisme: Exploiter à l’école la diversité des contextes européens. Résultat d’une étude internationale, Liège [En ligne].
Antos, Gerd (1996): Laien-Linguistik - Studien zu Sprach- und Kommunikationsproblemen im Alltag, Tübingen.
Aronin, Larissa/ Hufeisen, Britta (eds., 2009): The exploration of multilingualism. Development of research on L3, multilingualism and multiple language acquisition. AILA, Applied Linguistics Series (AALS), vol. 6, Amsterdam.
Auer, Peter/Wie, Li/Knapp, Karlfried/Antos, Gerd (eds., 2009): Handbook of multilingualism and multilingual communication, Berlin.
Bär, Marcus (2004): Europäische Mehrsprachigkeit durch rezeptive Kompetenzen: Konsequenzen für die Bildungspolitik, Aachen.
Bär, Marcus (2008) : „Enseignement plurilingue: la construction d’une compétence de lecture en plusieurs langues (romanes)”, in: Synergies Pays Germanophones 1, 113-122.
Bär, Marcus (2009): Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz. Fallstudien zu Interkomprehensionsunterricht mit Schülern der Klassen 8 bis 10, Tübingen.
Bär, Marcus (2010): „Motivation durch Interkomprehensionsunterricht – empirisch geprüft“, in: Doyé, Peter/Meißner, Franz-Josef (eds.), 281-290.
Bastian, Sabine/Burr, E. (2007): Mehrsprachigkeit in frankophonen Räumen, München.
Bastian, Sabine/van Vaerenbergh, Leona (2007): Multilinguale Kommunikation. Linguistische und translatorische Ansätze = Communication multilingue. Approches linguistiques et traductologiques = Multilingual communication. Linguistic and translational approaches, Translinguae 2, München.
Bausch, K.-Richard/Königs, Frank G./Krumm, Hans-Jürgen (eds., 2004): Mehrsprachigkeit im Fokus. Arbeitspapiere der 24. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts, Tübingen.
Blanchet, Philippe (ed., 2010) : Pratiques innovantes du plurilinguisme. Émergence et prise en compte en situations francophones. Actualité scientifique, Paris.
Böing, Mike (2004): „Interkomprehension und Mehrsprachigkeit im zweisprachig deutsch-französischen Bildungsgang. Ein Erfahrungsbericht”, in: französisch heute 35, 18-31.
Born, Joachim (2001): Mehrsprachigkeit in der Romania. Französisch in Kontakt und in der Konkurrenz zu anderen Sprachen, Wien.
Candelier, Michel/Camilleri-Grima, Antoinette/ Castellotti,Véronique/de Pietro, Jean-François/Lörincz, Ildiko/ Meissner, Franz-Joseph/ Schröder-Sura, Anna /Noguerol, Artur/ Molinié, Muriel (2007/2009): RePA. – Referenzrahmen für Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen. (Version 2)- Juillet 2007. Strasbourg: Europäische Kommission und Graz: CELV (Deutsche Fassung 2009).
Capucho, Filomena/Alves de Paula Martins, Adriana/Degache, Christian/Tost, Manuel (eds., 2008): Diálogos em Intercompreensão: Actas do Colóquio Internacional. Lisboa, 6-7-8 de Setembro de 2007, Lisboa (CD-ROM).
Caravolas, Jean-Antoine (1994): La didactique des langues: à l'ombre de Quintilien, Tübingen.
Caravolas, Jean-Antoine (1994): La didactique des langues: Précis d'histoire 1450-1700, Tübingen.
Caravolas, Jean-Antoine (2000): Histoire de la didactique des langues au siècle des lumières, Montréal/Tübingen.
Cichon, Peter (2006): Gelebte Mehrsprachigkeit. Akten des Wiener Kolloquiums zur individuellen und sozialen Mehrsprachigkeit, 5.6.XI.2005, Wien.
Cichon, Peter/Cichon, Ludmila (eds., 2009): Didaktik für eine gelebte Mehrsprachigkeit, Wien.
Dahmen, Wolfgang (1992): Germanisch und Romanisch in Belgien und Luxemburg. Romanistisches Kolloquium VI, Tübingen.
Crochot, Françoise (2008): „Les enseignants d’allemand et le plurilinguisme“, in: Les Langues Modernes 1, 25-33.
Dautermann, Irmgard (1995): Sprachkontakt in der Lorraine Romane: Eine lexikalische Studie zur Infiltration französischer und germanischer Elemente, Wien.
Decke-Cornill, Helene (2009): Fremdsprachendidaktik. Eine Einführung, Tübingen.
Doyé, Peter/Meißner, Franz-Joseph (eds., 2010): Lernerautonomie durch Interkomprehension. Promoting Learner Autonomy Through Intercomprehension. L’autonomisation de l’apprenant par l’intercompréhension. Tübingen.
Ehrhart, Sabine/ Hélot, Christine/ Le Nevez, Adam (eds., 2010). Plurilinguisme et formation des enseignants. Une approche critique. Mehrsprachigkeit in Schule und Unterricht, Band 10, Frankfurt a.M. u.a.
Escudé, Pierre (2010): Le point sur l'intercompréhension, clé du plurilinguisme. Didactique des langues étrangères, Paris.
Frings, Michael (2006): Mehrsprachigkeit und romanische Sprachwissenschaft an Gymnasien? Eine Studie zum modernen Französisch-, Italienisch- und Spanischunterricht, Stuttgart.
Helfrich, Uta (2007): „Sprachbewertungstraditionen, Identität und Sprachenpolitik: Die Diskussion um die Charte européenne des langues régionales ou minoritaires in Frankreich“, in: Döring, Martin/Osthus, Dietmar/Polzin-Haumann, Claudia (eds.): Sprachliche Diversität. Praktiken - Repräsentationen - Identitäten. Akten der Sektion Potenziale sprachlicher Diversität in den romanischen Sprachen des XXIX. Deutschen Romanistentages Saarbrücken (25.-29.9.2005), Bonn, 263-294.
Helfrich, Uta/Riehl, Claudia M. (eds., 1994): Mehrsprachigkeit in Europa - Hindernis oder Chance? Wilhelmsfeld.
Hildenbrand, Elke/Martin, Hannelore/Vences, Ursula (eds., 2012): Mehr Sprache(n) durch Mehrsprachigkeit : Erfahrungen aus Lehrerbildung und Unterricht, Berlin.
Hoffmann, Jean-Paul (1985): Standardsprache und Dialekt in der saarländisch-lothringisch-luxemburgischen Dreiländerecke, Luxembourg.
Hufeisen, Britta/Lutjeharms, Madeline (eds., 2005): Gesamtsprachencurriculum – Integrierte Sprachendidaktik – Common Curriculum. Theoretische Überlegungen und Beispiele der Umsetzung, Tübingen.
Jacobs, Jörn (2009): Wie sprechen unsere Nachbarn? Eine Gesamtübersicht über die Länder und Sprachen Europas, Aachen.
Janich, Nina/Greule, Albrecht (eds., 2002): Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch, Tübingen.
Janich, Nina/Thim-Mabrey, Christiane (eds., 2003): Sprachidentität – Identität durch Sprache, Tübingen.
Klein, Horst G./Stegmann, Tilbert D. (2000): EuroComRom - die sieben Siebe. Romanische Sprachen sofort lesen können, Aachen, 3. korr. Aufl.
Klein, Horst G./Meißner Franz-Joseph/Meissner, Claude/Stegmann, Tilbert D. (2004): EuroComRom- Les sept tamis: lire les langues romanes dès le départ. Avec une introduction à la didactique de l´eurocompréhension, Aachen.
Klein, Horst G./Reissner, Christina (2003): EuroComRom: Historische Grundlagen der romanischen Interkomprehension. Aachen, 2. Aufl.
Klein, Silvia H. (2004): Mehrsprachigkeitsunterricht an der Schule, Aachen.
Laumesfeld, Daniel/Rispail, Marielle (2000): La Lorraine francique: culture mosaïque et dissidence linguistique, Paris.
Lösch, Helmut (1997): Zweisprachigkeit in Elsass und Lothringen - gestern, heute und auch morgen: Versuch einer Bilanz, Wien.
Martinez, Hélène/Reinfried, Marcus (eds., 2006): Mehrsprachigkeitsdidaktik gestern, heute und morgen. Festschrift für Franz-Joseph Meissner zum 60. Geburtstag, Tübingen.
Meißner, Franz-Josef/Reinfried, Marcus (eds., 1998): Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte, Analysen, Lehrerfahrungen mit romanischen Fremdsprachen, Tübingen.
Meißner, Franz-Josef (ed., 2003): Mehrsprachigkeitsdidaktik zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland. Beiträge zum Kolloquium zur Mehrsprachigkeit zwischen Rhein und Maas, Goethe-Institut Lille (21/XI/2000), Tübingen.
Mejía, Anne-Marie de (ed., 2011): Empowering teachers across cultures. Enfoques críticos, perspectives croisées, Frankfurt a. M. u.a.
Meyer, Bernd/Apfelbaum, Birgit (eds., 2010): Multilingualism at work. From policies to practices in public, medical and business settings. Hamburg studies on multilingualism, Band 9, Amsterdam.
Mordellet-Roggenbuck, Isabelle (2012): Herausforderung Mehrsprachigkeit. Interkomprehension und Lesekompetenz in den zwei romanischen Sprachen Französisch und Spanisch, Landau.
Naglo, Kristian (2007): Rollen von Sprache in Identitätsbildungsprozessen multilingualer Gesellschaften in Europa. Eine vergleichende Betrachtung Luxemburgs, Südtirols und des Baskenlands, Frankfurt a.M.
Nieweler, Andreas (2002): „Den Französischunterricht öffnen für Mehrsprachigkeit. Anforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten“, in: französisch heute 1, 76-86.
Ollivier, Christian (2008): „Dimensions de l’intercompréhension et rétention lexicale dans des tâches en langues ‚inconnues’“, in: Capucho et al. (eds.), 67-81.
Putsche, Julia (2011): Spracheinstellungen von Grundschülerinnen und Grundschülern in einer Grenzregion. Qualitative Untersuchung in zwei paritätisch unterrichteten ersten Klassen mit Zielsprache Französisch, Bern u.a.
Raabe, Horst (42003): „Französisch“, in: Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/Krumm, Hans-Jürgen (eds.): Handbuch Fremdsprachenunterricht, vierte, vollst. neu bearb. Aufl, Tübingen/Basel, 533-538.
Reissner, Christina (2007): Die romanische Interkomprehension im pluridisziplinären Spannungsgefüge, Aachen.
Reissner, Christina (ed., 2009): Interkomprehension und Mehrsprachigkeit in Europa. Akten des XXXI. Romanistentages, Stuttgart
Reissner, Christina (2010): „La dissémination de l´intercompréhension romane dans l’enseignement scolaire en Allemagne“, in: Synergies Europe no 5: Intercompréhension(s): repères, interrogations et perspectives.
Riehl, Claudia Maria (2004): Sprachkontaktforschung. Eine Einführung, Tübingen.
Schwarze, Sabine/Werner, Edeltraud (eds., 2006): Identitätsbewahrung und Identitätsbegründung durch Sprache. Aktuelle Beiträge zum frankophonen Raum, Hamburg.
Stoye, Sabine (2000): Eurocomprehension: Der romanistische Beitrag für eine europäische Mehrsprachigkeit, Aachen.
Stratilaki, Sofia (2011): Discours et représentations du plurilinguisme, Frankfurt a. M.
Thije, Jan D. ten/Zeevaert, Ludger (eds., 2007): Receptive multilingualism. Linguistic analyses, language policies and didactic concepts, Amsterdam.
Trépos, Jean-Yves (2006): « Passeurs de langues. Eléments pour une sociologie de la connaissance (1). Diglossies ou dia-glossies ? Construction d’un outil d’analyse », in : Questions de Communication 10, 409-430.
Trépos, Jean-Yves (2007): « Passeurs de langues. Éléments pour une sociologie de la connaissance (2). Passages heureux et malheureux entre le français, le francique et l’allemand », in: Questions de communication 11, 389-411.
Truchot, Claude (2005): Multiculturalisme, Multilinguisme et milieu urbain, Besançon.
Watrinet, Régis (2008) : Patois romans de la Lorraine : recueil d'expressions, proverbes, dictons, coutumes et traditions avec illustrations, Courcelles-Chaussy.
Weber, Jean-Jacques (2009): Multilingualism, education and change. Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel 9, Frankfurt a.M.
Wiater, Werner (ed., 2006): Didaktik der Mehrsprachigkeit. Theoriegrundlagen und Praxismodelle, München.
Wiater, Werner/Videsott, Gerda (2010): Definition and classification of languages, Bozen.
Wissenschaftstraditionen kontrastiv
Adamzik, Kirsten (1998): Le début du texte. Titres et premières phrases (dans une perspective contrastive). In: Cahiers de Linguistique Française 20, 1998, 31-64.
- (1999): Wissenschaftliche Texte im Sprachvergleich (Deutsch-Französisch). Das Beispiel der (Fremdsprachen-)Philologien. In: Deutsch als Fremdsprache 1999, H. 3, 141-149.
Barmeyer, Christoph I. (2001): „On ne sait ce que l’on pratique.“ – Einblicke in das französische Bildungssystem unter Einbeziehung kulturspezifischer Aspekte.“ In: Französischheute 2001, H. 2, 170-186.
Clyne, Michael (1993): Pragmatik, Textstruktur und kulturelle Werte: Eine interkulturelle Perspektive. In: Schröder, Hartmut (Hg.) (1993): Fachtextpragmatik. Tübingen, 3-17.
Chevrel, Éric (2008): Traditionen des wissenschaftlichen Schreibens in der französischen Germanistik. In: Dalmas, Martine/Foschi, Marina/Neuland, Eva (Hg.) (2008): Wissenschaftliche Textsorten im Germanistikstudium deutsch-italienisch-französisch kontrastiv. Villa Vigoni 2007-2008, Band 1. Loveno di Menaggio, 71-77, [En ligne]
Ehlich, Konrad (2003). Universitäre Textarten, universitäre Struktur. In: Ehlich, Konrad, Angelika Steets (Hrsg.) Wissenschaftlich schreiben - lehren und lernen. Berlin/New York: de Gruyter: 13-28.
Ehlich,Konrad (2000):Deutsch als Wissenschaftssprache für das 21.Jahrhundert.In:German as a Fore gn Language (GFL)1/2000; [En ligne]
- (2003). Universitäre Textarten, universitäre Struktur. In: Ehlich, Konrad, Angelika Steets (Hrsg.) Wissenschaftlich schreiben - lehren und lernen. Berlin/New York: de Gruyter: 13-28.
- (2006):Mehrsprachigkeit in der Wissenschaftskommunikation – Illusion oder Notwendigkeit? In:Ehlich,Konrad /Heller,Dorothee (Hrsg.):Die Wissenschaft und ihre Sprachen. Bern u.a,17-36.
Eßer, Ruth (2006): Die deutschen Lehrer reden weniger und fragen mehr ..." Zur Relevanz des Kulturfaktors im DaF-Unterricht. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online], 11: 3, 18 , Abrufbar [En ligne]
Kaplan, Robert (1966): Cultural Thought Patterns in Inter-Cultural Education. In: Language Learning 1966, H. 16, 1-20.
Kotthoff,Helga (2009) :Positionierungen in Stipendienanträgen: Zur interkulturellen Pragmatik einer akademischen Gattung. In: Info DaF 6/2009, 483-498.
Pieth, Christa/ Adamzik, Kirsten. (1997). Anleitungen zum Schreiben universitärer Texte in kontrastiver Perspektive. In Adamzik, Kirsten, Antos, Gerd/Eva-Maria
Jakobs, Eva-Maria (Hrsg.): Domänen- und kulturspezifisches Schreiben. Frankfurt am Main, 31-69.
Prokopczuk, Klaudia (2007): Wissenschaftliche Nationalstile und Grounding. In: Deutsch als Fremdsprache 2007, H. 1, 26-31.
Schumann, Adelheid (2008): Interkulturelle Fremdheitserfahrungen ausländischer Studierender an deutschen Universitäten. In: Knapp, Annelie / Schumann, Adelheid (Hrsg.): Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im Studium, 29-50.
Starke, Günter/Zuchewicz, Tadeusz (2003): Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt a.M u.a.
Schwarze, Sabine (2007): Wissenschaftsstile in der Romania: Frankreich/Italien In: Auer, Peter/Baßler, Harald (Hg.) (2007): Reden und Schreiben in der Wissenschaft. Frankfurt a.M./New York, 185- 210.
Schubert, Katja/Viallon, Virginie (2003): Nicht deutsch, nicht französisch – binational? Zur Problematik des Erwerbs einer interkulturellen Wissenschaftskompetenz am Beispiel der ersten deutsch-französischen Sommeruniversität für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Berlin, Juli 2002). In: Lendemains. 28. Jahrgang, n° 109, 127-135.
Venohr, Elisabeth (2009): Wissenschaftstraditionen, Stil und Bewerten bei der Vermittlung des Deutschen als Wissenschaftssprache. Didaktische Überlegungen im deutsch-französischen universitären Kontext. In: Dalmas/Foschi Albert/Neuland, 305-322.
Lernerautonomie / Language Awareness
Bimmel, Peter/Rampillon, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien, Berlin u.a.
Doyé, Peter/Meissner, Franz-Joseph (eds., 2010). Lernerautonomie durch Interkomprehension: Projekte und Perspektiven/ L’autonomisation de l’apprenant par l’intercompréhension: projets et perspectives / Promoting Learner Autonomy through intercomprehension: projects and perspectives. Tübingen.
Edmondson, Will J./ House, Juliane (eds., 1997): „Language Awareness“, in: FLuL, 26.
Gnutzmann, Claus (1997): „Language Awareness“, in: Praxis des neusprachlichen Unterrichts 3, 227-237.
Gnutzmann, Claus (2010): „Language Awareness“, in: Hallet, Wolfgang/Königs, Frank G. (eds): Handbuch Fremdsprachendidaktik, Seelze, 115-119.
Hawkins, Eric (1984, 21987): Awareness of language: An Introduction, Cambridge.
Holec, Hery (1988): Autonomy and Self-Directed Learning: Present Fields of Application, Strasbourg: Council of Europe.
Jessner, Ulrike (1999): „Metalinguistic Awareness in Multilinguals: Cognitive Aspects of Third Language Learning”, in: Language Awareness 8:3 und 4, 201-209.
Martinez, Helene (2008): Lernerautonomie und Sprachenlernverständnis. Eine qualitative Untersuchung bei zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern romanischer Sprachen, Tübingen.
Martinez, Helene (2010): „Plurilingüismo, intercomprensión y autonomización: el papel de la tercera lengua en el desarollo de la autonomía”, in: Doyé/Meißner (eds.),146-160.
Morkötter, Steffi (2005): Language Awareness und Mehrsprachigkeit. Eine Studie zu Sprachbewusstheit und Mehrsprachigkeit aus der Sicht von Fremdsprachenlernern und Fremdsprachenlehrern, Frankfurt a.M.
Documents fondamentaux
Conseil de l‘Europe (1993): „Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Traité et rapports”, Strasbourg, [En ligne]
Europarat (2001): The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, [En ligne]
Europäische Kommission (1995): Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung: Lehren und Lernen. Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft. KOM (1995) 590 vom 29.11.1995, Strasbourg [En ligne]
Europarat (1997): Entschließung des Rates vom 16. Dezember 1997 über die frühzeitige Vermittlung der Sprachen der Europäischen Union [Amtsblatt C 1 vom 3.1.1998], [En ligne]
Hochrangige Gruppe Mehrsprachigkeit (2007): „Empfehlungen für das Sprachenlernen“, [En ligne](kurze Zsf. auf Deutsch En ligne)
Kommission der europäischen Gemeinschaften (2003): „MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT, DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN. Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt: Aktionsplan 2004 – 2006“, [En ligne]
Kommission der europäischen Gemeinschaften (2005): „MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT, DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN. Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit“ [KOM (2005) 596 endgültig], [En ligne]
Ministerium für Bildung [Saarland] (2011): Sprachenkonzept Saarland 2011, [En ligne]
Übersicht über aktuelle Entwicklungen in der europäischen Mehrsprachigkeitspolitik [En ligne]
PARTIE 3/3
Pratiques multilingues à l'université : une approche contrastive
Introduction
- I - Politiques linguistiques
Introduction
Eléments, facteurs, acteurs
La Sarre, dimension nationale et régionale
Dimension européenne
- II- Notions de linguistique contrastive
Systèmes, usages. Comprendre, traduire
Politique européenne pour le plurilinguisme
Intercompréhension
- III - Pragmatique et linguistique variationnelle
Introduction
Analyse du discours
Questions interculturelles, les langues des migrants
Traditions universitaires / styles d'enseignement / écrire dans une langue étrangère
Sommaire général
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (1/3) - Passages de langues et l…
TréposJean-YvesEhrhartSabinePolzin-HaumannClaudiaVenohrElisabethReissnerChristina« Passages de langues et légitimités linguistiques » est la première partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme. Il est utile d’aborder les
-
Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (2/3) - L'écologie linguistique …
TréposJean-YvesEhrhartSabinePolzin-HaumannClaudiaVasco CorreiaSarahVenohrElisabethReissnerChristina« L'écologie linguistique en milieu éducatif : l'exemple luxembourgeois » est la deuxième partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme. L’intervention
-
L'innovation
TréposJean-YvesKutyOlgierdLeverattoJean-MarcPremière partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - Introduction
-
Introduction à une socio-anthropologie des marchés
TréposJean-YvesKutyOlgierdLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Première partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? ». Les auteurs vous
-
La société à l'aube du XXIème siècle : Introduction
TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleLa société à l'aube du XXIème siècle : Introduction Ce programme est l'introduction d'un cours de sociologie construit en quatre chapitres, sur « La société à l'aube du XXIème siècle ». Sous le mode
-
La société des individus ?
TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleCe programme est le premier chapitre d'un cours de sociologie sur « La société à l'aube du XXIème siècle ». Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia-Amadio nous proposent d'aborder
-
La société post-moderne ?
TréposJean-YvesStupkaChristelleSinigaglia-AmadioSabrinaCe programme est le deuxième chapitre d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia
-
La société du risque ?
TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleCe programme est le troisième chapitre d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia
-
La société sans qualités ?
TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleCe programme est le quatrième chapitre d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia
-
La société à l'aube du XXIème siècle : Conclusion
TréposJean-YvesStupkaChristelleSinigaglia-AmadioSabrinaCe programme est la conclusion d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia-Amadio
-
Trois leçons de sociologie (1) Sur le travail de terrain
FreidsonEliotBeckerHoward SaulTréposJean-Yves"Sur le travail de terrain" constitue le premier volet d'une série de trois programmes construits à partir des interventions de Howard S. Becker et de Eliot Freidson. Ce système de "master class" est
-
Trois leçons de sociologie (3) Professions, expertises, compétences
FreidsonEliotBeckerHoward SaulTréposJean-Yves"Professions, expertises, compétences" constitue le troisième et dernier volet d'une série de programmes construits à partir d'interventions de Howard S. Becker et de Eliot Freidson. Leurs réactions,
Sur le même thème
-
Des langues inventées au télégraphe : technologies du langage et machines linguistiques sous la Rév…
CostaJamesAvec le télégraphe de Chappe, James Costa rappelle que les machines aussi ingénieuses soient-elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte humain, social et politique...
-
1 – Evolution des paradigmes culturels. 1
NobileLuca"Evolution des paradigmes culturels (1)" par Luca Nobile, Université de Bourgogne
-
Langue et culture créoles : Politique linguistique
ChadyShimeen-KhanGeorgerFabriceSciences du langage - Langue et culture créoles #11 - Politique linguistique
-
Les nouvelles voies de l'énonciation - Dans l'intimité de la recherche
Colas-BlaiseMarionDonderoMaria GiuliaBasso FossaliPierluigiVallespirMathildeSoirée "Les nouvelles voies de l'énonciation", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 7 juin 2023 au Forum de la FMSH
-
-
La propagande dans le contexte politique italien
Cette conférence, donnée dans le cadre du programme PandheMic (Propagande : héritages et mutations contemporaines) , a été l'occasion d'attirer l’attention sur la transformation des stratégies de
-
André Pézard traducteur de Dante ou le choix inactuel et délibéré de l’archaïsme
Notre intervention ouvre la série des rencontres sur les traductions de l'IMEC avec un sujet complexe et contrasté. Pour l'italianisme français et pour la traductologie italo-française, le fonds d
-
Les témoignages des locuteurs du Calvados : étude linguistique et dialectale
La communication traite de l'étude linguistique et dialectologique d'un corpus de dix témoignages oraux d'habitants du Calvados, ayant vécu les bombardements du 6 juin 1944. Les témoins ont répondu
-
Lexicographie bilingue : enseignement de l’italien et traduction dans deux grammaires italiennes éc…
Les deux grammaires ici comparées, parues à Londres en 1821 (manuel de Veneroni-Zotti) et à Paris en 1865 (manuel de Vergani-Ferrari), sont représentatives de deux conceptions différentes de la langue
-
Illudere, deludere : penser la violence comme un ‘jeu’ dans la culture romaine
Dans le débat anthropologique des dernières décennies une place de plus en plus importante est occupée par l’étude des systèmes métaphoriques que chaque culture produit. En partant du principe que la
-
Mercure, Woden, Óðinn. Comment et pourquoi on a “nordicisé” les divinités gréco-romaines
Le phénomène d’interpretatio des noms divins est bien connu et étudié dans le cadre des religions polythéistes de l’Antiquité : l’interpretatio romana des divinités grecques en est l’exemple le plus
-
Concordances géolinguistiques en zone Manche-Atlantique. Études de termes maritimes celtiques et ro…
Daniel Le Bris, maître de conférences en langues celtiques et chercheur au Centre de Recherche Bretonne et Celtique de Brest, étudie les concordances qui peuvent exister entre les aires linguistiques